.
Artikel 1
Artikel 2
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#§ 1
#§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
#§ 6
#§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§22
#§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
#§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
#§ 38
#§ 39
§ 40
#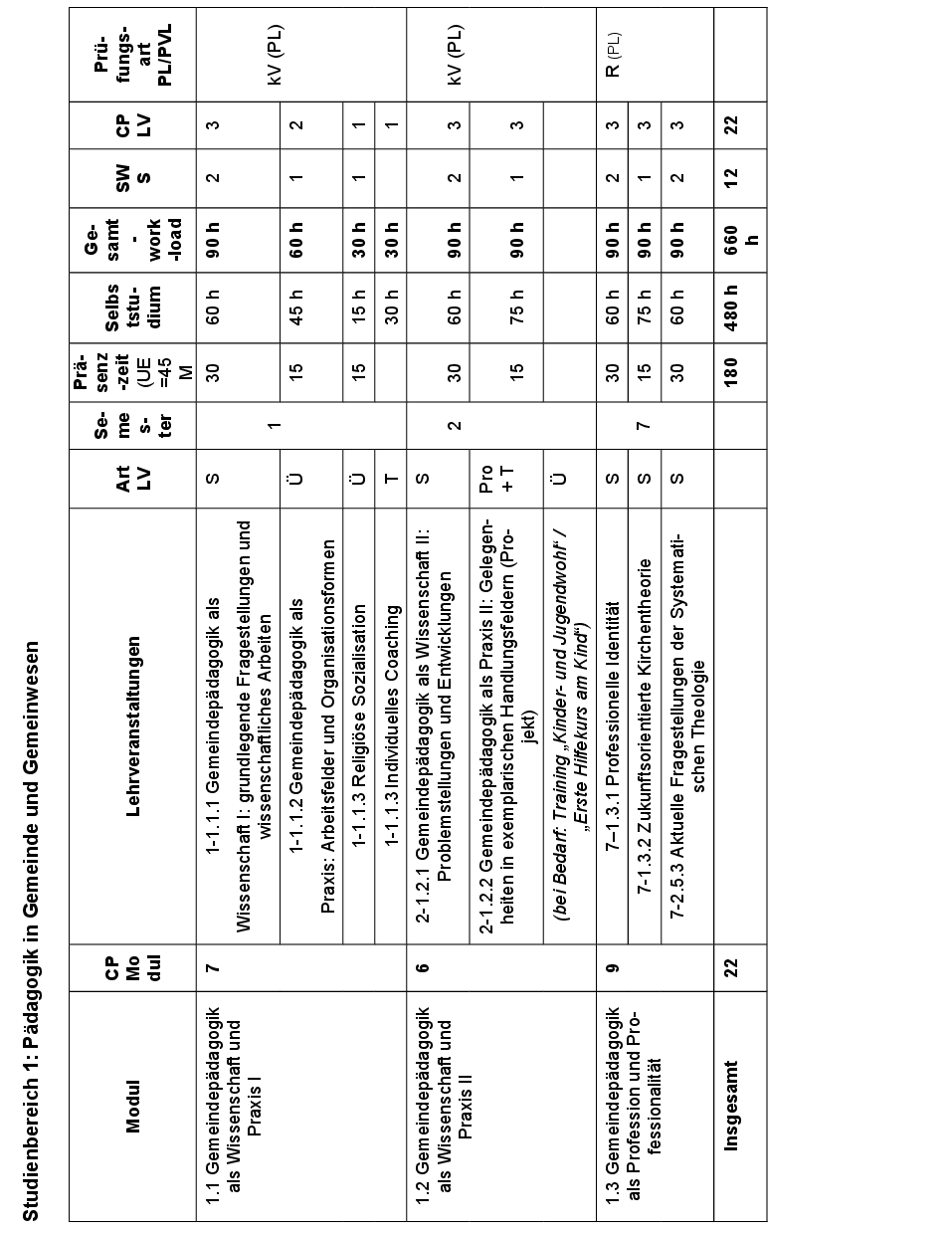
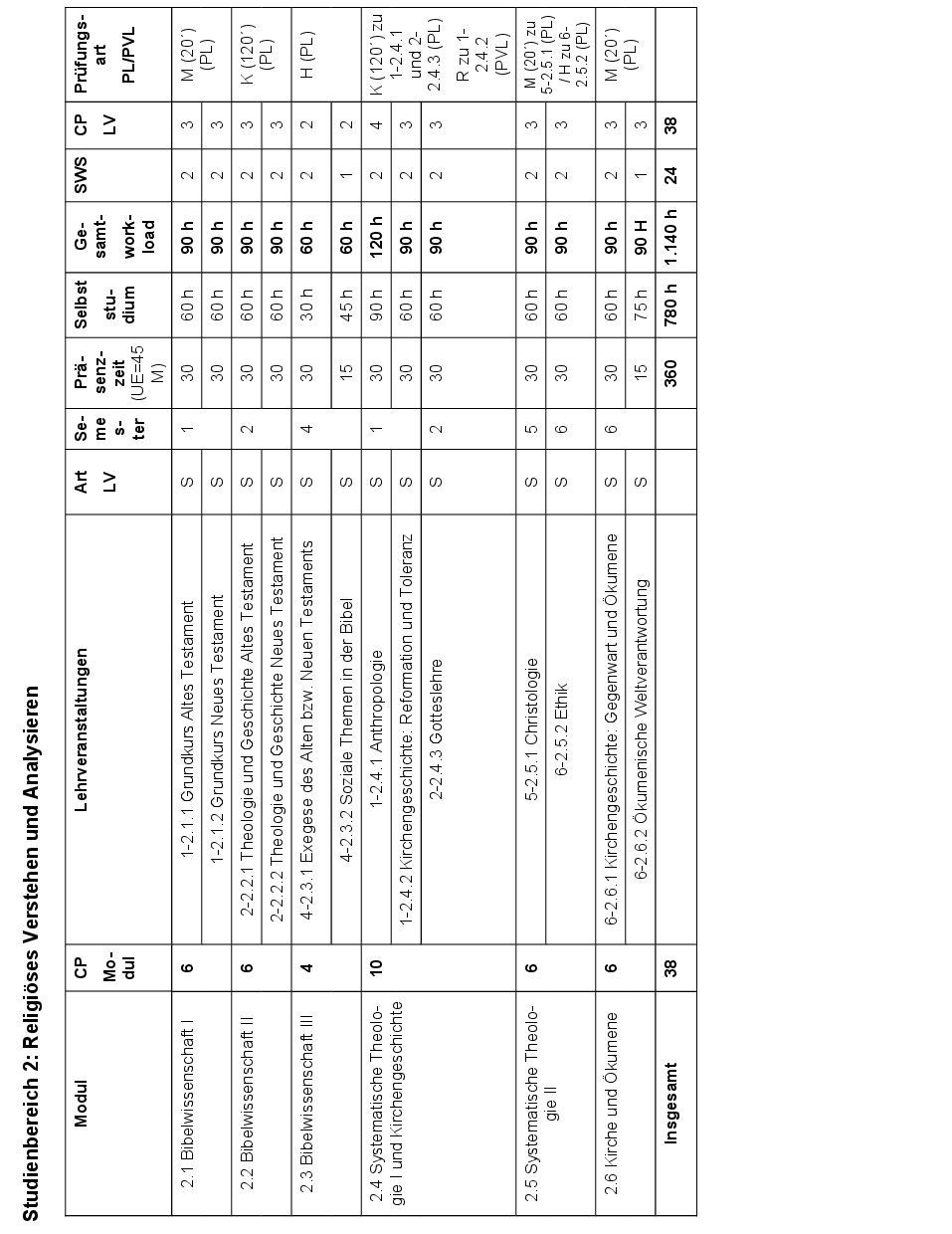
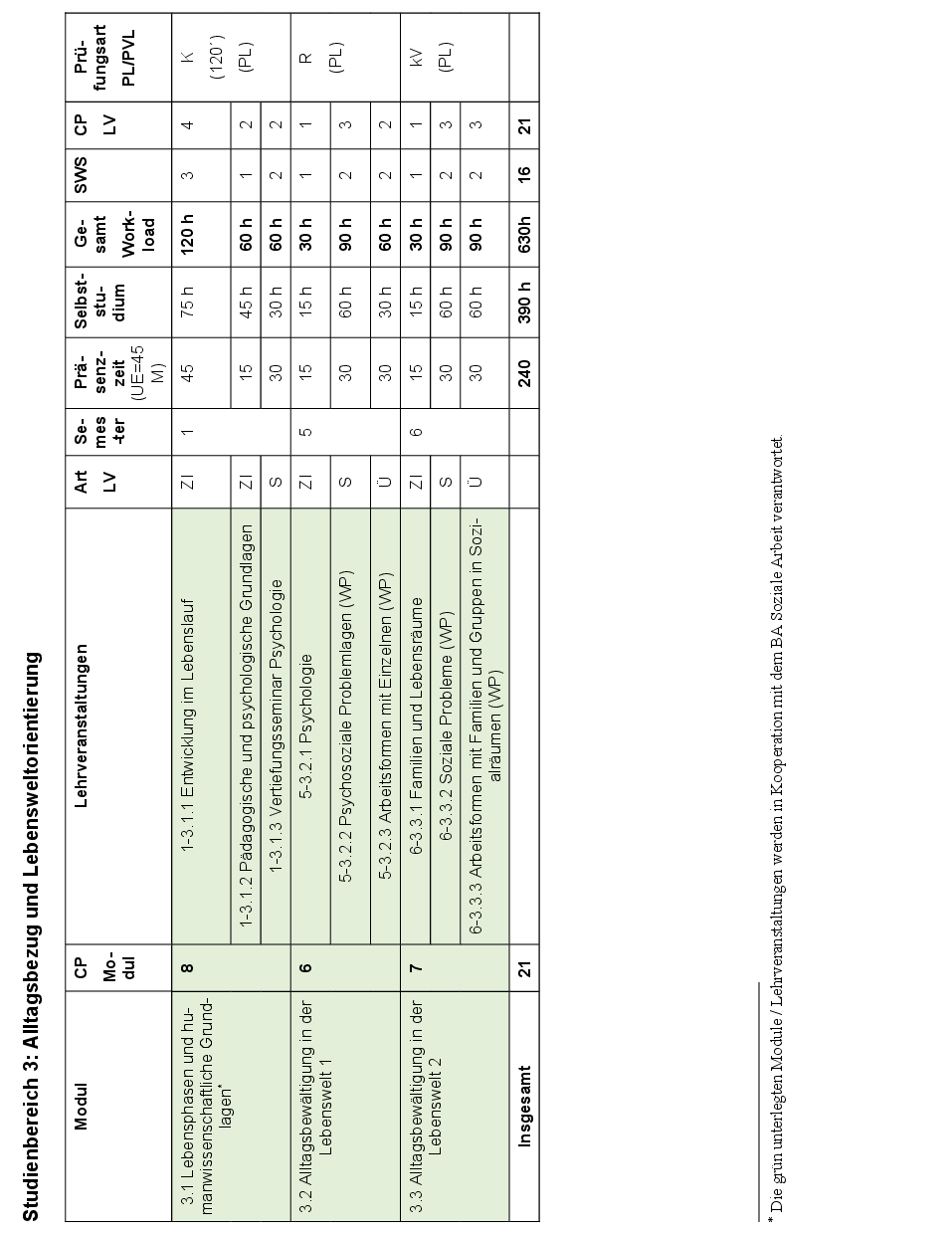
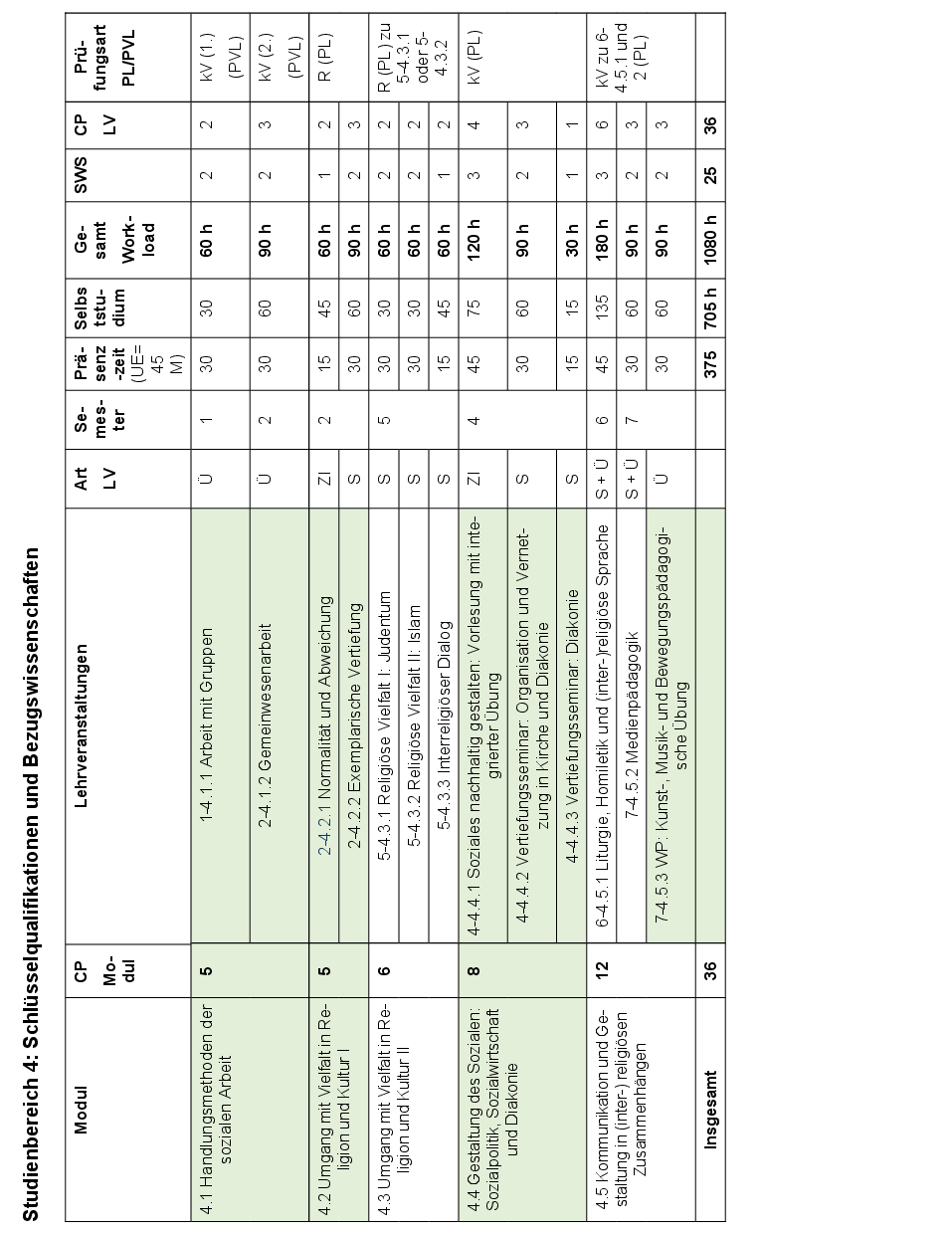
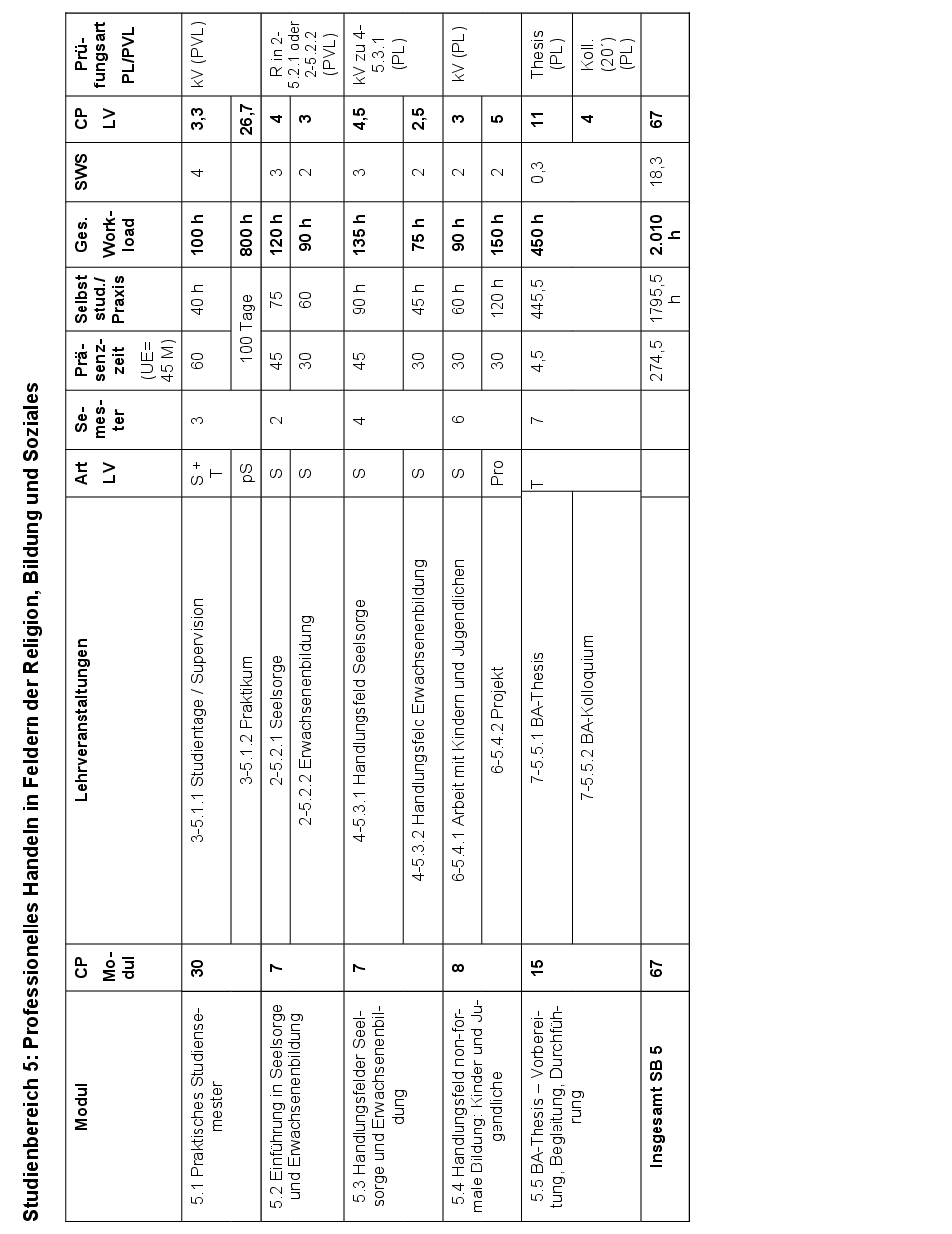
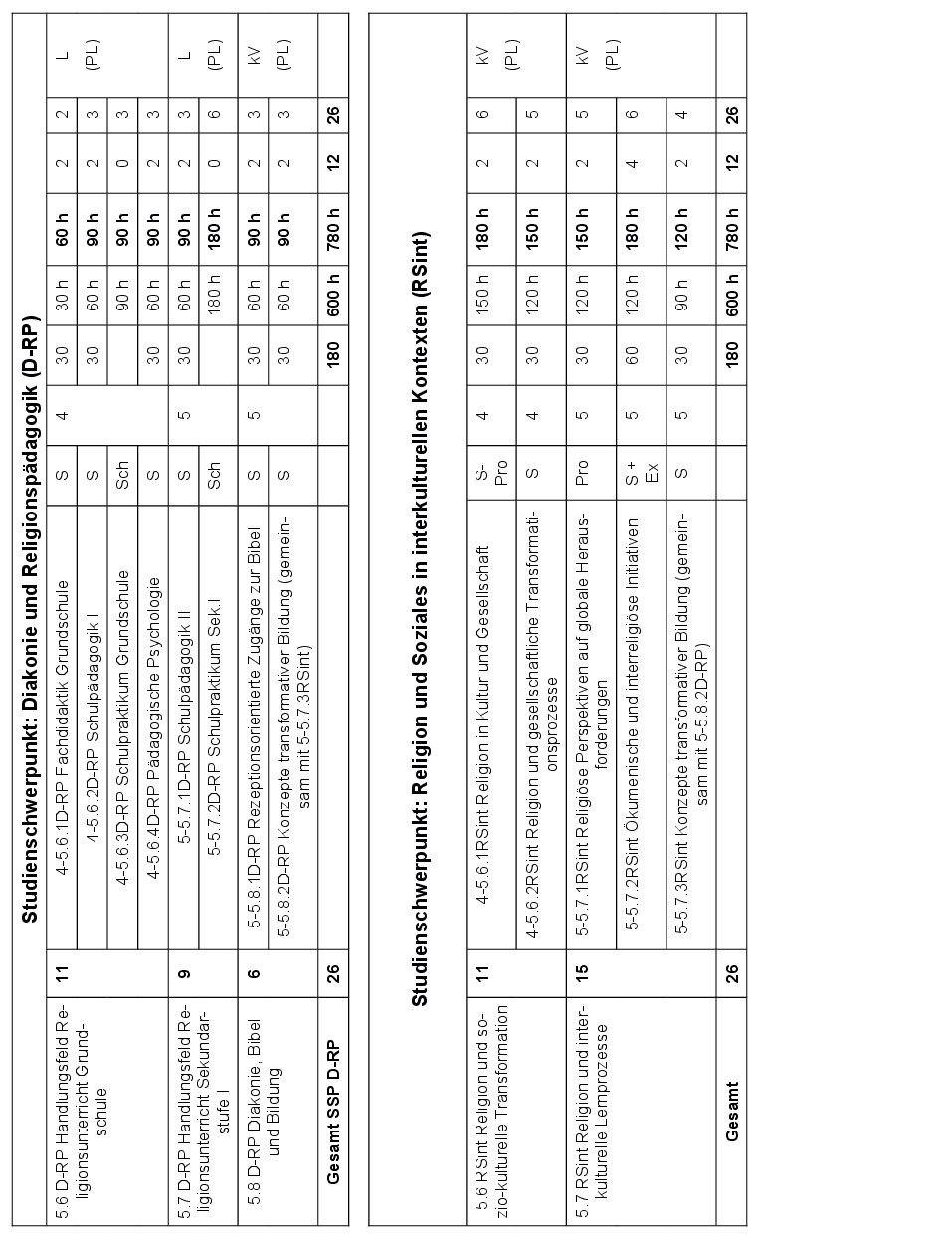
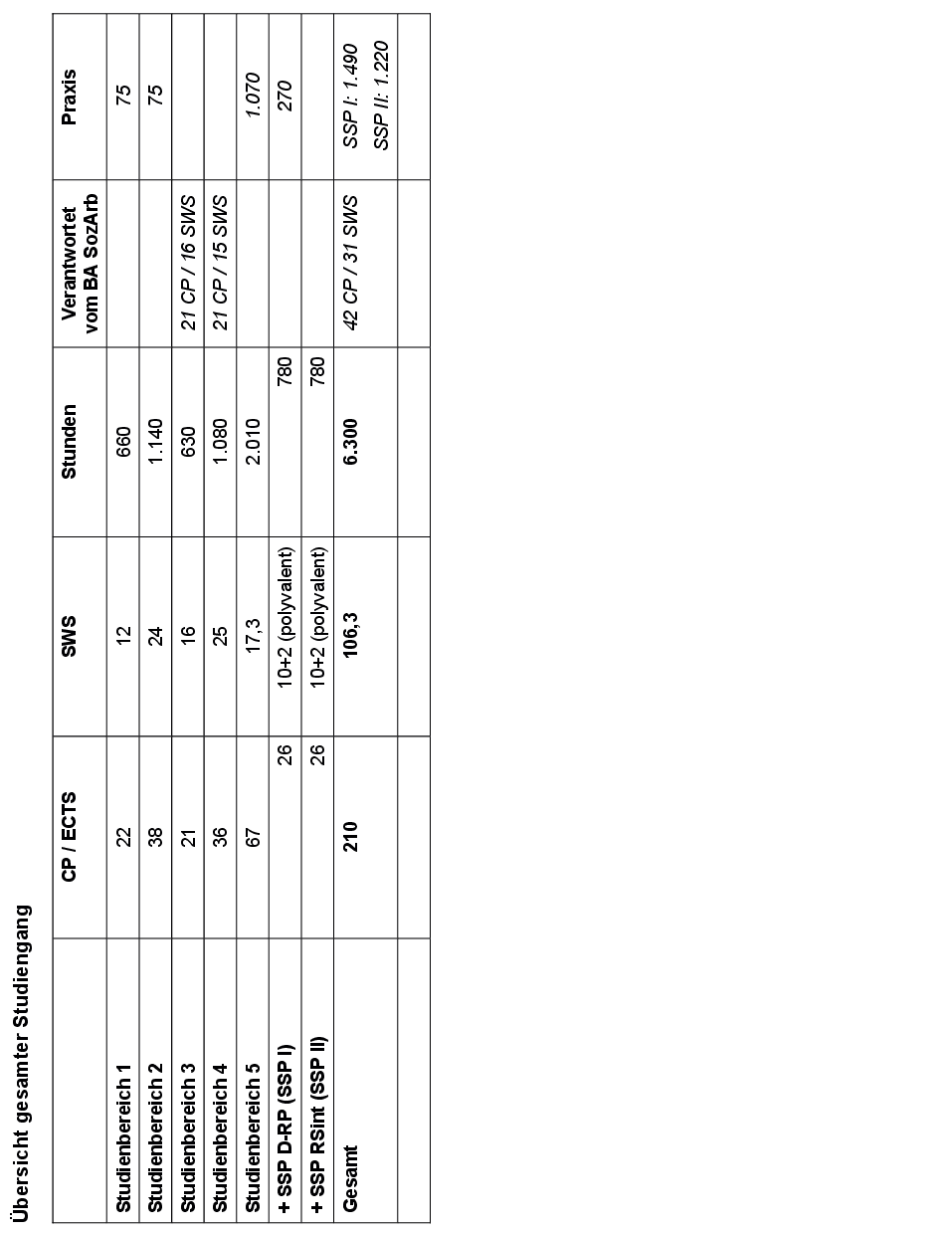
#§ 41
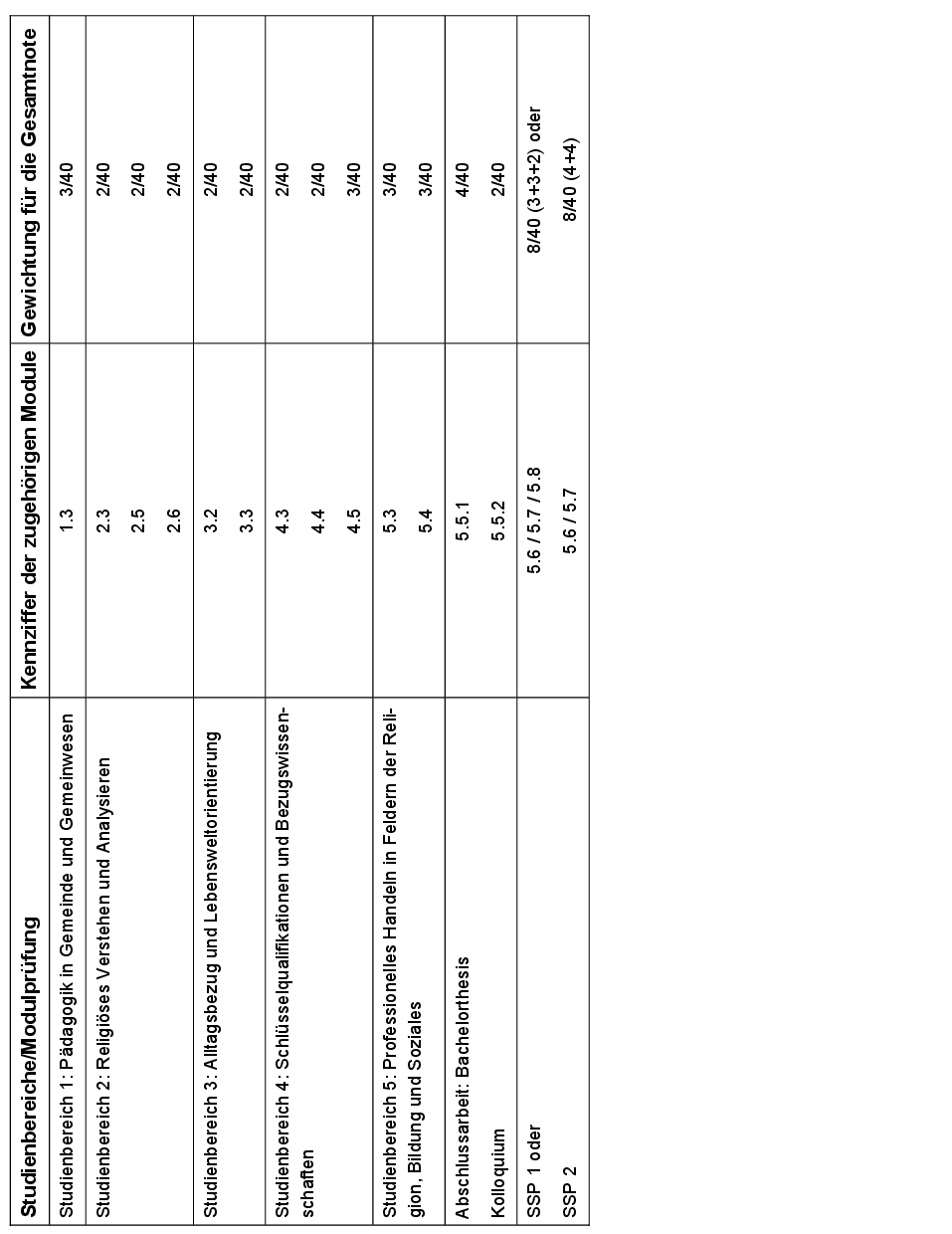
#§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
#§ 46
§ 47
§ 48
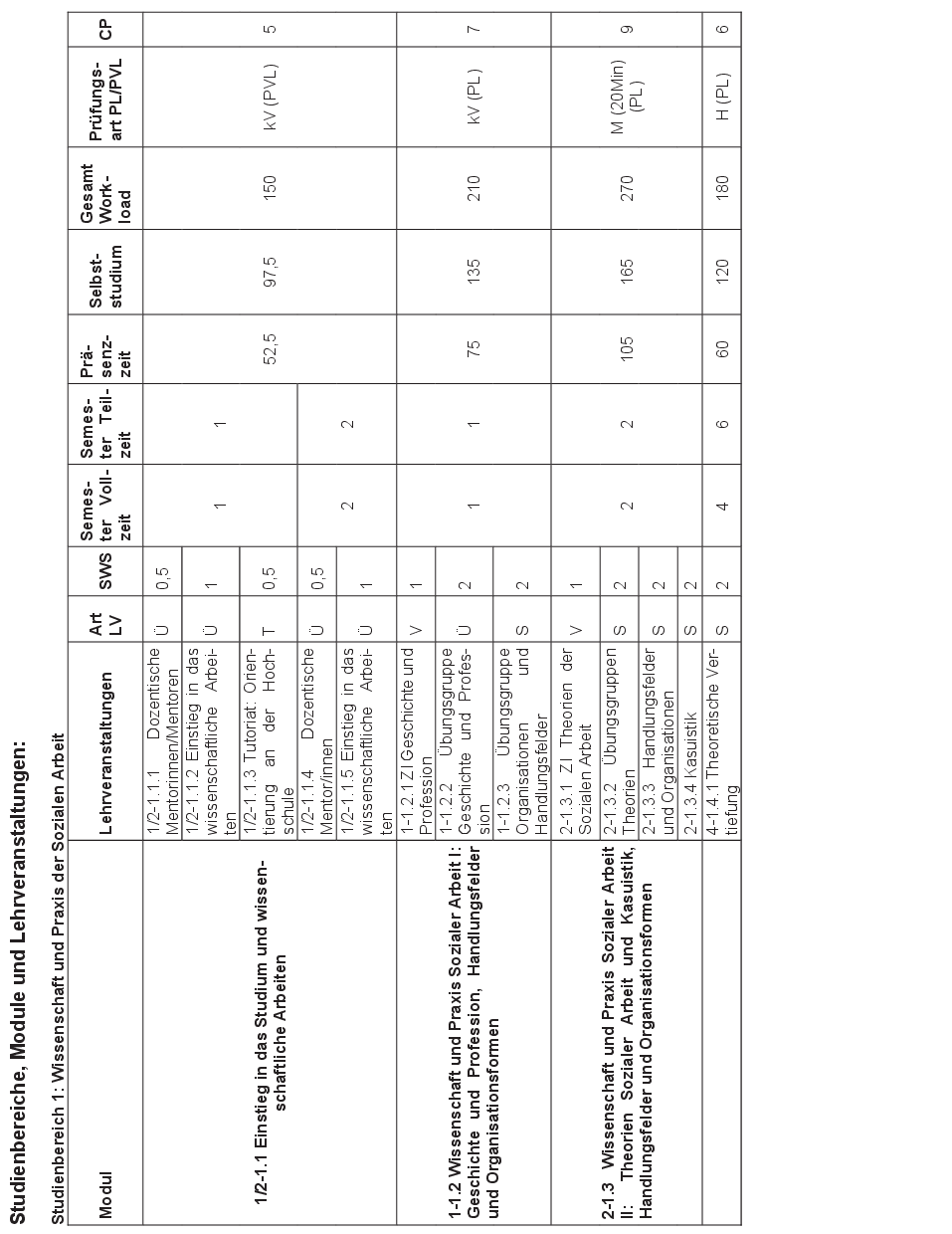
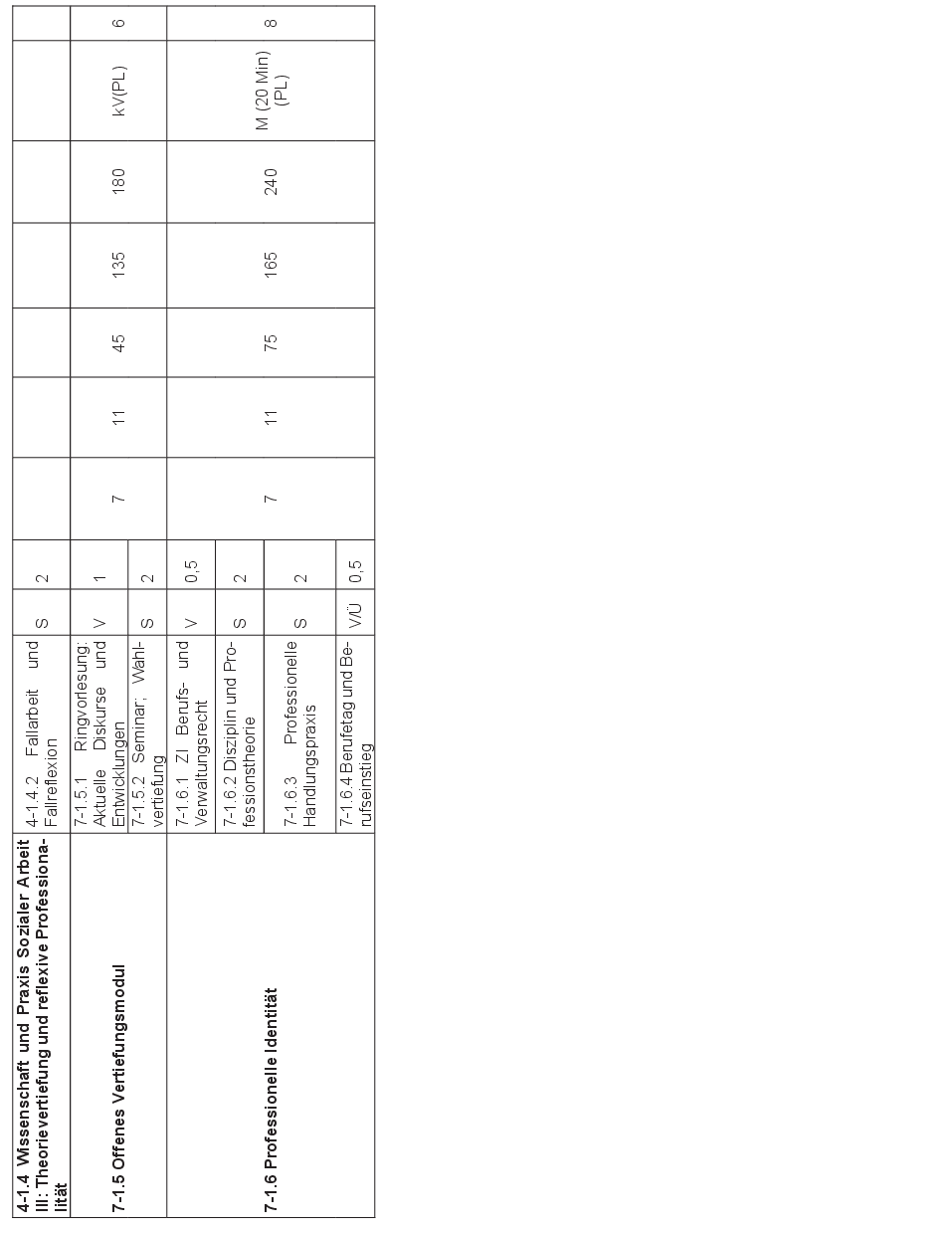
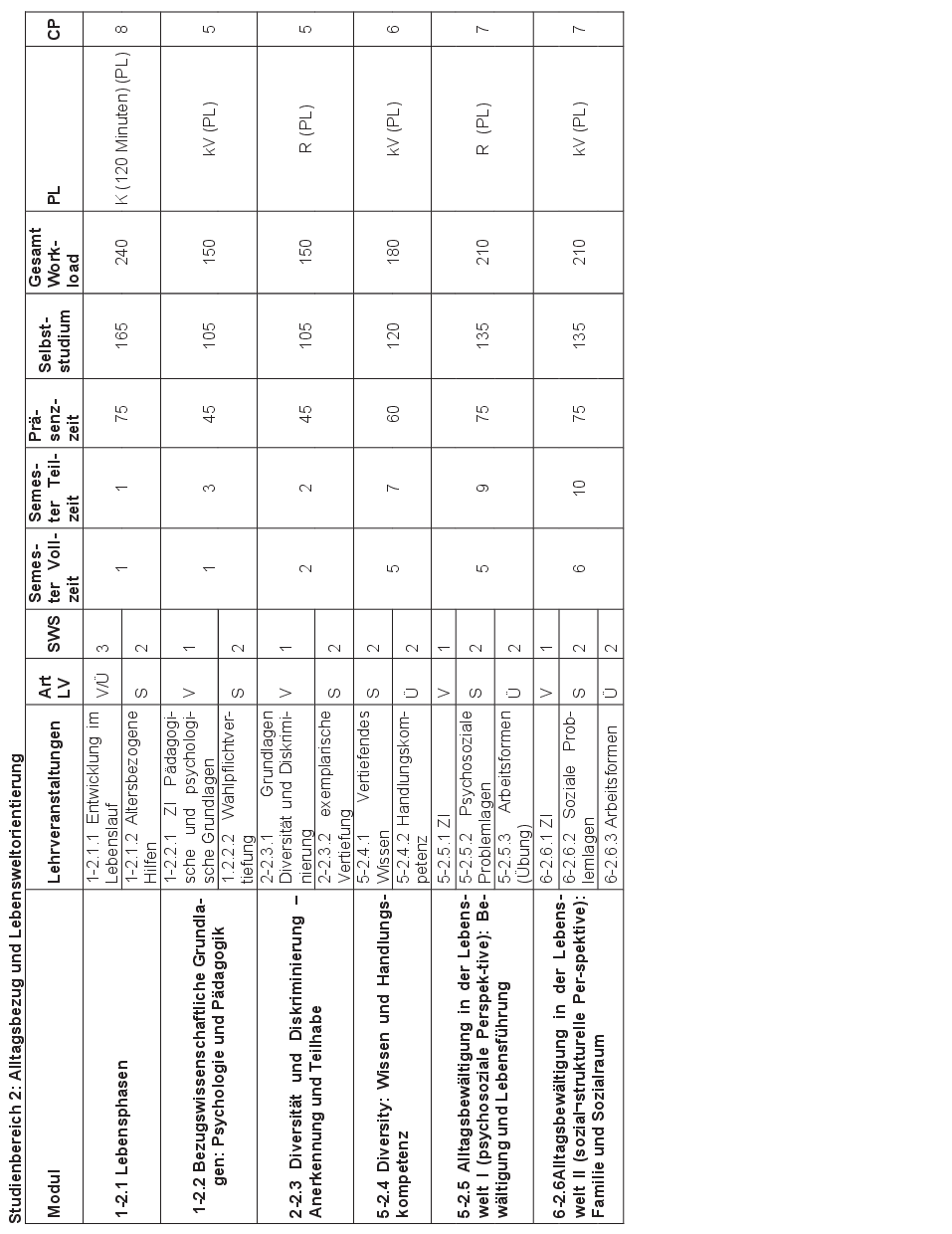
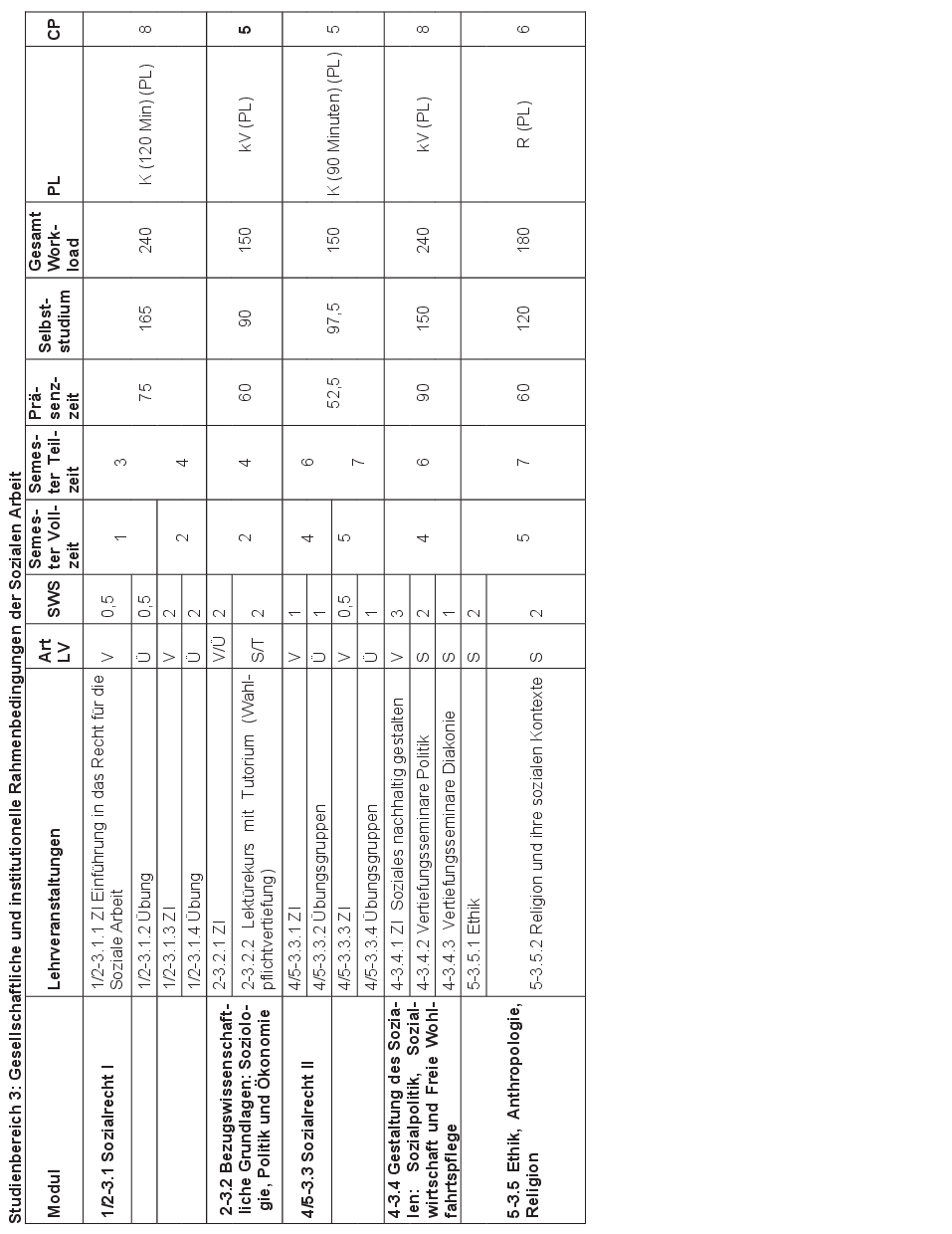
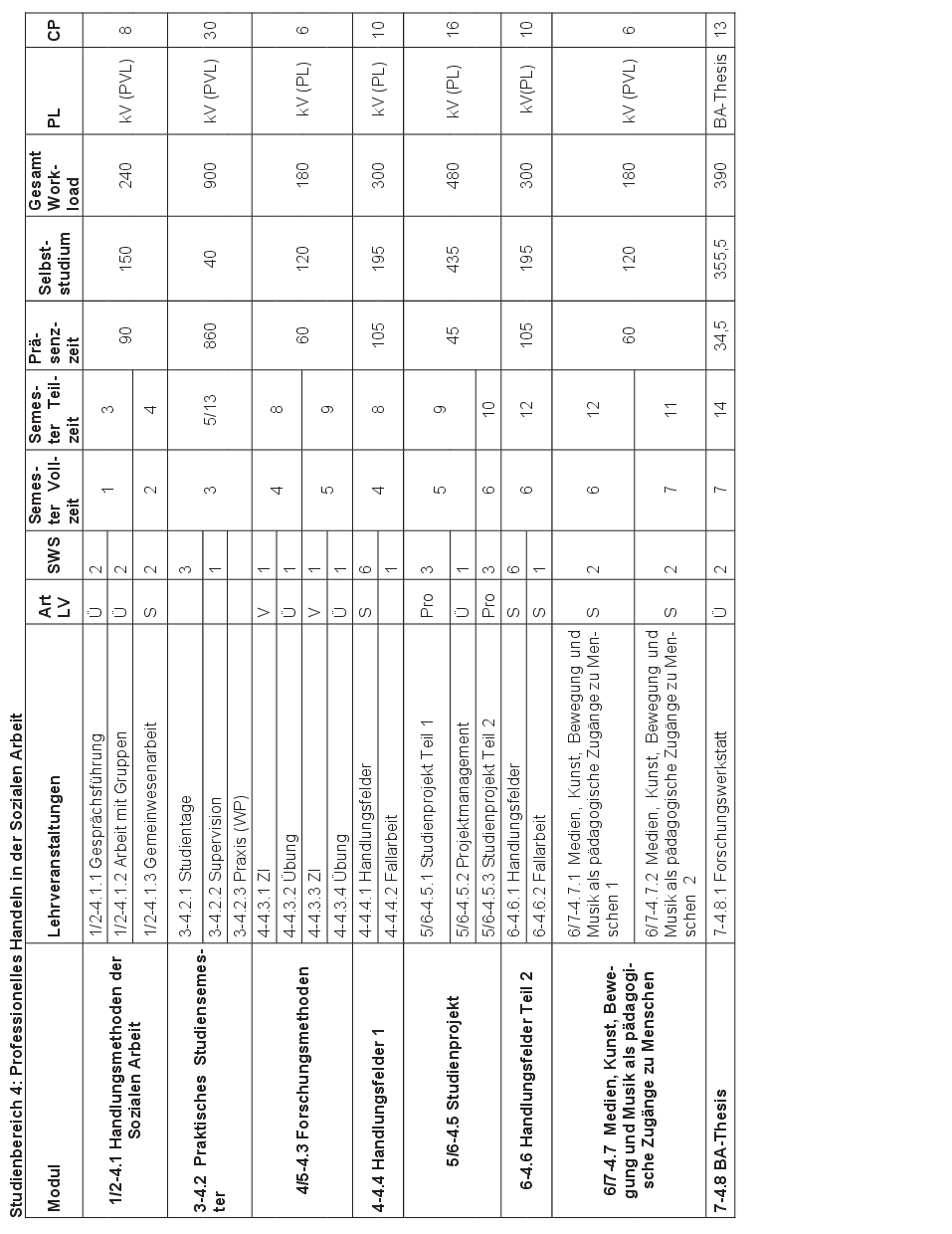 #
#§ 49
#§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
####
Ausgabe 5Karlsruhe, 07. Mai 2025
Rechtsverordnungen
Nr. 41Rechtsverordnung
zur Änderung der Rechtsverordnung
über die Bildung von Substanzerhaltungsrücklagen
zur Änderung der Rechtsverordnung
über die Bildung von Substanzerhaltungsrücklagen
Vom 12. März 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 Kirchliches Gesetz über die Vermögensverwaltung und die Haushaltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden (KVHG) vom 25. Oktober 2018 (GVBl. 2019, S. 3), zuletzt geändert am 27. April 2023 (GVBl., Nr. 51, S. 103) folgende Rechtsverordnung:
#Artikel 1
Änderung der SubstanzerhaltungsrücklageRVO
Die Rechtsverordnung über die Bildung von Substanzerhaltungsrücklagen (SubstanzerhaltungsrücklageRVO - SERL-RVO) vom 22. Juli 2020 (GVBl. S. 285), zuletzt geändert am 23. November 2023 (GVBl. 2024, Nr. 8, S. 17) wird wie folgt geändert:
- § 2 Abs. 12 wird wie folgt gefasst:„(12) Bei kirchlichen Wirtschaftsbetrieben nach § 60 KVHG ergibt sich der Zuführungsbetrag zur Substanzerhaltungsrücklage aus der Höhe des Abschreibungsbetrages des Anlagevermögens. Es können Zuschläge auf den Zuführungsbetrag vorgenommen werden, um der Erhöhung der Baukosten und dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen.“
- In § 2a Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bei“ die Wörter „Pfarrhäusern, Dienstwohnungen,“ eingefügt.
- § 4 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
- a.
- In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
- b.
- In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
- c.
- Es werden folgende Nummern 5 und 6 angefügt:
„5. Maßnahmen der Bauunterhaltung über 2.000 Euro pro Maßnahme an Gebäuden, die nach dem Ressourcensteuerungsgesetz als gelb oder rot klassifiziert sind, und 20.000 Euro pro Jahr nicht übersteigen, wenn die Substanzerhaltungsrücklage für das Gebäude gebildet wurde und zur Verfügung steht und
6. Baumaßnahmen nach § 4 Abs. 3 BauG-RVO.“
#Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 12. März 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
Nr. 42Rechtsverordnung des Zweckverbandes Rhein-Neckar
(RVO Verwaltungszweckverband Rhein-Neckar – RVO-VzV-Rhein-Neckar)
(RVO Verwaltungszweckverband Rhein-Neckar – RVO-VzV-Rhein-Neckar)
Vom 7. April 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 107 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 19. April 2024 (GVBl., Nr. 70, S. 137) , folgende Rechtsverordnung:
#§ 1
Name und Zweck
(
1
)
Zur Erledigung der Aufgaben ihrer Verwaltung bilden unter Fortführung des bisher bereits bestehenden Verwaltungszweckverbandes
- der Evangelische Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach,
- der Evangelische Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz,
- der Evangelische Kirchenbezirk Kraichgau
- sowie die in der Anlage näher aufgeführten Kirchengemeinden der Kirchenbezirke
einen Verwaltungszweckverband.
(
2
)
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet der Verwaltungszweckverband ein Verwaltungs- und Serviceamt ein.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband trägt den Namen
„Evangelischer Verwaltungszweckverband
Rhein-Neckar“
Rhein-Neckar“
(
4
)
Der Verwaltungszweckverband hat seinen Sitz in Meckesheim.
(
5
)
Das Verbandsgebiet umfasst den räumlichen Bereich der Evangelischen Kirchenbezirke Neckargemünd-Eberbach, Südliche Kurpfalz und Kraichgau sowie den räumlichen Bereich der Kirchengemeinde Steinachtal des Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße und den räumlichen Bereich der Kirchengemeinden Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell, Michelbach Unterschwarzach und Neunkirchen-Oberschwarzach-Neckarkatzenbach des Kirchenbezirks Mosbach.
#§ 2
Aufgaben des Verwaltungszweckverbandes
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband nimmt durch das Verwaltungs- und Serviceamt für seine Mitglieder Aufgaben nach dem Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz (VSA-G) wahr.
(
2
)
Für kirchliche Rechtsträger, die unter der Aufsicht der Landeskirche stehen oder die Mitglieder des Diakonischen Werks Baden sind, können aufgrund gesondert zu schließender Vereinbarungen weitergehende Leistungen erbracht werden. Leistungen an weitere Rechtsträger können erbracht werden, wenn der Verwaltungsrat dem zustimmt und der Evangelische Oberkirchenrat die Übernahme genehmigt.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband kann die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen übernehmen.
(
4
)
Die Geschäftsverteilung im Verwaltungs- und Serviceamt kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
#§ 3
Verwaltungsrat
(
1
)
Organ des Verwaltungszweckverbandes ist der Verwaltungsrat. Durch diesen wird der Verwaltungszweckverband geleitet.
(
2
)
Der Verwaltungsrat ist zuständig für:
- Begleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes in wesentlichen Fragen der Umsetzung des VSA-G sowie bei grundlegenden strukturellen Veränderungen,
- Erlass einer Geschäftsordnung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis einer vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen Mustergeschäftsordnung,
- die Bestellung einer oder mehrerer Stellvertretungen für die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes im Benehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat (§ 12 Abs. 1 VSA-G),
- personal- und dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der Stellvertretungen der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes,
- Mitwirkung bei der Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Verwaltungs- und Serviceamtes nach § 12 Abs. 1 VSA-G,
- Mitwirkung beim Erlass einer Gebührenordnung oder Erlass einer Gebührenordnung nach Maßgabe von § 14 VSA-G,
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Verwaltungszweckverbandes,
- die Feststellung der Jahresrechnung,
- Wahl einer oder eines Verwaltungsratsvorsitzenden sowie der Stellvertretung nach § 5,
- Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung sowie Erteilung der Entlastung der Person im Vorsitzendenamt sowie der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis der geprüften Jahresrechnungen,
- Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat zur Änderung der Rechtsverordnung des Verwaltungszweckverbandes nach Beteiligung der Verbandsmitglieder.
(
3
)
Dem Verwaltungsrat gehören an:
- die Dekaninnen oder Dekane der beteiligten Kirchenbezirke,
- aus jedem Kirchenbezirk zwei Personen, die von der Bezirkssynode des Kirchenbezirks aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder gewählt werden und die die Interessen der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk im Verwaltungsrat vertreten sollen. Die Personen sollen Mitglied eines Kirchengemeinderates einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks sein. Sie sollen Kompetenzen in wirtschaftlichen, rechtlichen oder personalwirtschaftlichen Fragestellungen besitzen. Die Bezirkssynode kann beschließen, die Zahl der von ihr zu wählenden Personen zu verringern.
(
4
)
Im Falle der Vereinigung der Kirchenbezirke Neckargemünd-Eberbach und Kraichgau nach Artikel 33 Abs.1 GO sind statt zwei Personen nach Absatz 3 Nr. 2 je drei Personen in den Verwaltungsrat zu entsenden.
(
5
)
Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 1 wird die Stellvertretung aufgrund einer Entscheidung des Bezirkskirchenrates durch die Dekanstellvertretung oder durch die Schuldekanin oder den Schuldekan wahrgenommen. Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 werden je Kirchenbezirk zwei Personen als 1. und 2. Stellvertretung durch die Bezirkssynode gewählt.
(
6
)
Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 und die Stellvertretungen werden für die Dauer der Wahlperiode der Ältestenkreise bestellt. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu entsenden.
(
7
)
Die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes ist beratendes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht. Weitere beratende Mitglieder können nicht bestellt werden. Zur Erörterung spezifischer Fragestellungen können Personen beratend für einzelne Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden. Die Stellvertretungen der Geschäftsführung können im Einvernehmen mit der Geschäftsführung vom Verwaltungsrat ständig oder zeitweise beratend hinzugezogen werden.
#§ 4
Sitzungen des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wird schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte von der oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Die Sitzungen können nach den Regelungen der Digitalsitzungs-RVO digital durchgeführt werden.
(
2
)
Für die Sitzungen gelten § 13 Leitungs- und Wahlgesetz sowie die Artikel 108 bis 111 der Grundordnung entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
(
3
)
Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal jährlich. In dringenden Fällen kann der Verwaltungsrat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats dies unter Angabe der Gründe schriftlich beantragt.
#§ 5
Vorsitz des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode des Verwaltungsrats aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.
(
2
)
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
- führt den Vorsitz des Verwaltungsrates, beruft die Sitzungen ein und leitet diese,
- sorgt für die ordnungsgemäße Protokollierung und Durchführung der Beschlüsse,
- ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der Geschäftsführung und stellvertretenden Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 2 VSA-G),
- ist die mittelbare Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 3 VSA-G),
- führt die Auflösung nach § 8 durch.
(
3
)
Die rechtliche Vertretung des Verwaltungszweckverbandes erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Die rechtliche Vertretung kann durch Geschäftsordnung auf die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes umfänglich oder teilweise übertragen werden.
#§ 6
Geschäftrsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes
Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt das Verwaltungs- und Serviceamt im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Beschlüsse des Verwaltungsrates. Sie ist Dienstvorgesetze und Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes.
#§ 7
Finanazierung
(
1
)
Soweit die Aufgabenerfüllung nicht zentral durch eine Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz finanziert wird, erfolgt die Finanzierung des Verwaltungszweckverbandes durch Umlagen oder Gebühren nach Maßgabe von § 14 VSA-G.
(
2
)
Im Falle der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 3 werden die Betriebskosten mit dem zuständigen kommunalen Träger abgerechnet sowie Elternbeiträge nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.
#§ 8
Auflösung
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband kann durch Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO aufgelöst oder mit einem anderen Verwaltungszweckverband zusammengelegt werden.
(
2
)
Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten im Verhältnis der in den letzten fünf Jahren geleisteten Umlagen oder Gebühren auf die einzelnen Verbandsmitglieder über, soweit nicht in der Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO anderes geregelt ist.
#§ 9
Übergangsvorschrift
Der Verwaltungsrat wird nach den Regelungen dieser Rechtsverordnung mit Beginn der Amtszeit der Ältestenkreise nach den allgemeinen Kirchenwahlen 2025 neu gebildet. Bis dahin besteht der Verwaltungsrat in der bisherigen Besetzung fort; insoweit gelten die Regelungen der in § 10 Abs. 2 genannten Rechtsverordnung fort.
#§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(
1
)
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(
2
)
Die Rechtsverordnung vom 15. Juli 2003 (GVBl. S. 153) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 7. April 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
#Anlage
1. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach
Bammental
Brombach
Dilsberg
Eberbach
Friedrichsdorf
Gaiberg
Gauangelloch
Lobenfeld
Mauer
Meckesheim und Mönchzell
Mückenloch
Neckargemünd
Schönbrunn
Steinachtal
Waldhilsbach
Waldwimmersbach
Wiesenbach
Brombach
Dilsberg
Eberbach
Friedrichsdorf
Gaiberg
Gauangelloch
Lobenfeld
Mauer
Meckesheim und Mönchzell
Mückenloch
Neckargemünd
Schönbrunn
Steinachtal
Waldhilsbach
Waldwimmersbach
Wiesenbach
2. Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz
Altlußheim
Baiertal-Dielheim
Eppelheim
Hockenheim
Ketsch
Leimen
Neulußheim
Nußloch
Oftersheim
Plankstadt
Reilingen
Sandhausen
Schwetzingen
St. Ilgen
St. Leon-Rot
Walldorf
Wiesloch
Wiesloch-Schatthausen
Brühl
Baiertal-Dielheim
Eppelheim
Hockenheim
Ketsch
Leimen
Neulußheim
Nußloch
Oftersheim
Plankstadt
Reilingen
Sandhausen
Schwetzingen
St. Ilgen
St. Leon-Rot
Walldorf
Wiesloch
Wiesloch-Schatthausen
Brühl
3. Kirchenbezirk Kraichgau
Adelshofen
Angelbachtal
Bad Rappenau
Daisbach
Dühren
Elsenz-Rohrbach
Eppingen
Eschelbach
Eschelbronn
Neidenstein
Gemmingen
Stebbach
Heinsheim
Helmstadt
Bargen
Flinsbach
Hilsbach-Weiler
Hoffenheim
Ittlingen-Richen
Kirchardt
Berwangen
Mühlbach
Mühlhausen-Tairnbach
Neckarbischofsheim
Untergimpern
Obergimpern
Ehrstädt
Grombach
Reichartshausen
Reihen
Adersbach
Hasselbach
Siegelsbach
Wollenberg
Sinsheim
Rohrbach-Steinsfurt
Treschklingen
Babstadt
Waibstadt
Waldangelloch
Zuzenhausen
Epfenbach
Spechbach
Angelbachtal
Bad Rappenau
Daisbach
Dühren
Elsenz-Rohrbach
Eppingen
Eschelbach
Eschelbronn
Neidenstein
Gemmingen
Stebbach
Heinsheim
Helmstadt
Bargen
Flinsbach
Hilsbach-Weiler
Hoffenheim
Ittlingen-Richen
Kirchardt
Berwangen
Mühlbach
Mühlhausen-Tairnbach
Neckarbischofsheim
Untergimpern
Obergimpern
Ehrstädt
Grombach
Reichartshausen
Reihen
Adersbach
Hasselbach
Siegelsbach
Wollenberg
Sinsheim
Rohrbach-Steinsfurt
Treschklingen
Babstadt
Waibstadt
Waldangelloch
Zuzenhausen
Epfenbach
Spechbach
4. Kirchengemeinde aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Neckar-Bergstraße
Steinachtal
5. Kirchengemeinden aus dem Evangelischen Kirchenbezirk Mosbach
Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell
Michelbach Unterschwarzach
Neunkirchen-Oberschwarzach-Neckarkatzenbach
Michelbach Unterschwarzach
Neunkirchen-Oberschwarzach-Neckarkatzenbach
Nr. 43Rechtsverordnung des Zweckverbandes Neckar-Bergstraße
(RVO Verwaltungszweckverband Neckar-Bergstraße – RVO-VzV-N-Berg)
(RVO Verwaltungszweckverband Neckar-Bergstraße – RVO-VzV-N-Berg)
Vom 7. April 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 107 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 19. April 2024 (GVBl., Nr. 70, S. 137), folgende Rechtsverordnung:
#§ 1
Name und Zweck
(
1
)
Zur Erledigung der Aufgaben ihrer Verwaltung bilden unter Fortführung des bisher bereits bestehenden Verwaltungszweckverbandes
- der Evangelische Kirchenbezirk Neckar-Bergstraße
- sowie die in der Anlage näher aufgeführten Kirchengemeinden des Kirchenbezirks
einen Verwaltungszweckverband.
(
2
)
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet der Verwaltungszweckverband ein Verwaltungs- und Serviceamt ein.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband trägt den Namen
„Evangelischer Verwaltungszweckverband
Neckar-Bergstraße“
(
4
)
Der Verwaltungszweckverband hat seinen Sitz in Weinheim.
(
5
)
Das Verbandsgebiet umfasst den räumlichen Bereich des Evangelischen Kirchenbezirkes Neckar-Bergstraße abzüglich des räumlichen Bereiches der Kirchengemeinde Steinachtal.
#§ 2
Aufgaben des Verwaltungszweckverbandes
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband nimmt durch das Verwaltungs- und Serviceamt für seine Mitglieder Aufgaben nach dem Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz (VSA-G) wahr.
(
2
)
Für kirchliche Rechtsträger, die unter der Aufsicht der Landeskirche stehen oder die Mitglieder des Diakonischen Werks Baden sind, können aufgrund gesondert zu schließender Vereinbarungen weitergehende Leistungen erbracht werden. Leistungen an weitere Rechtsträger können erbracht werden, wenn der Verwaltungsrat dem zustimmt und der Evangelische Oberkirchenrat die Übernahme genehmigt.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband kann die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen übernehmen.
(
4
)
Die Geschäftsverteilung im Verwaltungs- und Serviceamt kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
#§ 3
Verwaltungsrat
(
1
)
Organ des Verwaltungszweckverbandes ist der Verwaltungsrat. Durch diesen wird der Verwaltungszweckverband geleitet.
(
2
)
Der Verwaltungsrat ist zuständig für:
- Begleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes in wesentlichen Fragen der Umsetzung des VSA-G sowie bei grundlegenden strukturellen Veränderungen,
- Erlass einer Geschäftsordnung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis einer vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen Mustergeschäftsordnung,
- die Bestellung einer oder mehrerer Stellvertretungen für die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes im Benehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat (§ 12 Abs. 1 VSA-G),
- personal- und dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der Stellvertretungen der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes,
- Mitwirkung bei der Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Verwaltungs- und Serviceamtes nach § 12 Abs. 1 VSA-G,
- Mitwirkung beim Erlass einer Gebührenordnung oder Erlass einer Gebührenordnung nach Maßgabe von § 14 VSA-G,
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Verwaltungszweckverbandes,
- die Feststellung der Jahresrechnung,
- Wahl einer oder eines Verwaltungsratsvorsitzenden sowie der Stellvertretung nach § 5,
- Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung sowie Erteilung der Entlastung der Person im Vorsitzendenamt sowie der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis der geprüften Jahresrechnungen,
- Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat zur Änderung der Rechtsverordnung des Verwaltungszweckverbandes nach Beteiligung der Verbandsmitglieder.
(
3
)
Dem Verwaltungsrat gehören an:
- die Dekanin oder der Dekan des Kirchenbezirks,
- aus dem Kirchenbezirk vier Personen, die von der Bezirkssynode des Kirchenbezirks aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder gewählt werden und die die Interessen der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk im Verwaltungsrat vertreten sollen. Die Personen sollen Mitglied eines Kirchengemeinderates einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks sein. Sie sollen Kompetenzen in wirtschaftlichen, rechtlichen oder personalwirtschaftlichen Fragestellungen besitzen. Die Bezirkssynode kann beschließen, die Zahl der von ihr zu wählenden Personen zu verringern.
(
4
)
Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 1 wird die Stellvertretung aufgrund einer Entscheidung des Bezirkskirchenrates durch die Dekanstellvertretung oder durch die Schuldekanin oder den Schuldekan wahrgenommen. Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 werden je Kirchenbezirk zwei Personen als 1. und 2. Stellvertretung durch die Bezirkssynode gewählt.
(
5
)
Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 und die Stellvertretungen werden für die Dauer der Wahlperiode der Ältestenkreise bestellt. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu entsenden.
(
6
)
Die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes ist beratendes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht. Weitere beratende Mitglieder können nicht bestellt werden. Zur Erörterung spezifischer Fragestellungen können Personen beratend für einzelne Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden. Die Stellvertretungen der Geschäftsführung können im Einvernehmen mit der Geschäftsführung vom Verwaltungsrat ständig oder zeitweise beratend hinzugezogen werden.
#§ 4
Sitzungen des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wird schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte von der oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Die Sitzungen können nach den Regelungen der Digitalsitzungs-RVO digital durchgeführt werden.
(
2
)
Für die Sitzungen gelten § 13 Leitungs- und Wahlgesetz sowie die Artikel 108 bis 111 der Grundordnung entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
(
3
)
Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal jährlich. In dringenden Fällen kann der Verwaltungsrat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats dies unter Angabe der Gründe schriftlich beantragt.
#§ 5
Vorsitz des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode des Verwaltungsrats aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.
(
2
)
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
- führt den Vorsitz des Verwaltungsrates, beruft die Sitzungen ein und leitet diese,
- sorgt für die ordnungsgemäße Protokollierung und Durchführung der Beschlüsse,
- ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der Geschäftsführung und stellvertretenden Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 2 VSA-G),
- ist die mittelbare Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 3 VSA-G),
- führt die Auflösung nach § 8 durch.
(
3
)
Die rechtliche Vertretung des Verwaltungszweckverbandes erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Die rechtliche Vertretung kann durch Geschäftsordnung auf die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes umfänglich oder teilweise übertragen werden.
#§ 6
Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes
Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt das Verwaltungs- und Serviceamt im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Beschlüsse des Verwaltungsrates. Sie ist Dienstvorgesetze und Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes.
#§ 7
Finanzierung
(
1
)
Soweit die Aufgabenerfüllung nicht zentral durch eine Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz finanziert wird, erfolgt die Finanzierung des Verwaltungszweckverbandes durch Umlagen oder Gebühren nach Maßgabe von § 14 VSA-G.
(
2
)
Im Falle der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 3 werden die Betriebskosten mit dem zuständigen kommunalen Träger abgerechnet sowie Elternbeiträge nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.
#§ 8
Auflösung
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband kann durch Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO aufgelöst oder mit einem anderen Verwaltungszweckverband zusammengelegt werden.
(
2
)
Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten im Verhältnis der in den letzten fünf Jahren geleisteten Umlagen oder Gebühren auf die einzelnen Verbandsmitglieder über, soweit nicht in der Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO anderes geregelt ist.
#§ 9
Übergangsvorschrift
Der Verwaltungsrat wird nach den Regelungen dieser Rechtsverordnung mit Beginn der Amtszeit der Ältestenkreise nach den allgemeinen Kirchenwahlen 2025 neu gebildet. Bis dahin besteht der Verwaltungsrat in der bisherigen Besetzung fort; insoweit gelten die Regelungen der in § 10 Abs. 2 genannten Rechtsverordnung fort.
#§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(
1
)
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(
2
)
Die Rechtsverordnung vom 24. August 2004 (GVBl. S. 166) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 7. April 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
#Anlage
Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße
Altenbach
Dossenheim
Edingen
Heddesheim
Heiligkreuz-Oberflockenbach
Hemsbach-Sulzbach
Hirschberg-Großsachsen
Hohensachsen
Ilvesheim
Ladenburg
Laudenbach
Leutershausen
Lützelsachsen
Neckarhausen
Schriesheim
Weinheim
Dossenheim
Edingen
Heddesheim
Heiligkreuz-Oberflockenbach
Hemsbach-Sulzbach
Hirschberg-Großsachsen
Hohensachsen
Ilvesheim
Ladenburg
Laudenbach
Leutershausen
Lützelsachsen
Neckarhausen
Schriesheim
Weinheim
Nr. 44Rechtsverordnung des Zweckverbandes Mittelbaden
(RVO Verwaltungszweckverband Mittelbaden – RVO-VzV-Mittelbaden)
(RVO Verwaltungszweckverband Mittelbaden – RVO-VzV-Mittelbaden)
Vom 7. April 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 107 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 19. April 2024 (GVBl., Nr. 70, S. 137), folgende Rechtsverordnung:
#§ 1
Name und Zweck
(
1
)
Zur Erledigung der Aufgaben ihrer Verwaltung bilden unter Fortführung des bisher bereits bestehenden Verwaltungszweckverbandes
- der Evangelische Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal,
- der Evangelische Kirchenbezirk Badischer Enzkreis,
- der Evangelische Kirchenbezirk Karlsruhe-Land
- sowie die in der Anlage näher aufgeführten Kirchengemeinden der Kirchenbezirke
einen Verwaltungszweckverband.
(
2
)
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet der Verwaltungszweckverband ein Verwaltungs- und Serviceamt ein.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband trägt den Namen
„Evangelischer Verwaltungszweckverband
Mittelbaden“
(
4
)
Der Verwaltungszweckverband hat seinen Sitz in Bretten.
(
5
)
Das Verbandsgebiet umfasst den räumlichen Bereich der Evangelischen Kirchenbezirke Bretten-Bruchsal, Badischer Enzkreis und Karlsruhe-Land.
#§ 2
Aufgaben des Verwaltungszweckverbandes
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband nimmt durch das Verwaltungs- und Serviceamt für seine Mitglieder Aufgaben nach dem Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz (VSA-G) wahr.
(
2
)
Für kirchliche Rechtsträger, die unter der Aufsicht der Landeskirche stehen oder die Mitglieder des Diakonischen Werks Baden sind, können aufgrund gesondert zu schließender Vereinbarungen weitergehende Leistungen erbracht werden. Leistungen an weitere Rechtsträger können erbracht werden, wenn der Verwaltungsrat dem zustimmt und der Evangelische Oberkirchenrat die Übernahme genehmigt.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband kann die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen übernehmen.
(
4
)
Die Geschäftsverteilung im Verwaltungs- und Serviceamt kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
#§ 3
Verwaltungsrat
(
1
)
Organ des Verwaltungszweckverbandes ist der Verwaltungsrat. Durch diesen wird der Verwaltungszweckverband geleitet.
(
2
)
Der Verwaltungsrat ist zuständig für:
- Begleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes in wesentlichen Fragen der Umsetzung des VSA-G sowie bei grundlegenden strukturellen Veränderungen,
- Erlass einer Geschäftsordnung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis einer vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen Mustergeschäftsordnung,
- die Bestellung einer oder mehrerer Stellvertretungen für die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes im Benehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat (§ 12 Abs. 1 VSA-G),
- personal- und dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der Stellvertretungen der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes,
- Mitwirkung bei der Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Verwaltungs- und Serviceamtes nach § 12 Abs. 1 VSA-G,
- Mitwirkung beim Erlass einer Gebührenordnung oder Erlass einer Gebührenordnung nach Maßgabe von § 14 VSA-G,
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Verwaltungszweckverbandes,
- die Feststellung der Jahresrechnung,
- Wahl einer oder eines Verwaltungsratsvorsitzenden sowie der Stellvertretung nach § 5,
- Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung sowie Erteilung der Entlastung der Person im Vorsitzendenamt sowie der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis der geprüften Jahresrechnungen,
- Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat zur Änderung der Rechtsverordnung des Verwaltungszweckverbandes nach Beteiligung der Verbandsmitglieder.
(
3
)
Dem Verwaltungsrat gehören an:
- die Dekaninnen oder Dekane der beteiligten Kirchenbezirke,
- aus jedem Kirchenbezirk zwei Personen, die von der Bezirkssynode des Kirchenbezirks aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder gewählt werden und die die Interessen der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk im Verwaltungsrat vertreten sollen. Die Personen sollen Mitglied eines Kirchengemeinderates einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks sein. Sie sollen Kompetenzen in wirtschaftlichen, rechtlichen oder personalwirtschaftlichen Fragestellungen besitzen. Die Bezirkssynode kann beschließen, die Zahl der von ihr zu wählenden Personen zu verringern.
(
4
)
Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 1 wird die Stellvertretung aufgrund einer Entscheidung des Bezirkskirchenrates durch die Dekanstellvertretung oder durch die Schuldekanin oder den Schuldekan wahrgenommen. Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 werden je Kirchenbezirk zwei Personen als 1. und 2. Stellvertretung durch die Bezirkssynode gewählt.
(
5
)
Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 und die Stellvertretungen werden für die Dauer der Wahlperiode der Ältestenkreise bestellt. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu entsenden.
(
6
)
Die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes ist beratendes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht. Weitere beratende Mitglieder können nicht bestellt werden. Zur Erörterung spezifischer Fragestellungen können Personen beratend für einzelne Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden. Die Stellvertretungen der Geschäftsführung können im Einvernehmen mit der Geschäftsführung vom Verwaltungsrat ständig oder zeitweise beratend hinzugezogen werden.
#§ 4
Sitzungen des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wird schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte von der oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Die Sitzungen können nach den Regelungen der Digitalsitzungs-RVO digital durchgeführt werden.
(
2
)
Für die Sitzungen gelten § 13 Leitungs- und Wahlgesetz sowie die Artikel 108 bis 111 der Grundordnung entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
(
3
)
Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal jährlich. In dringenden Fällen kann der Verwaltungsrat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats dies unter Angabe der Gründe schriftlich beantragt.
#§ 5
Vorsitz des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode des Verwaltungsrats aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.
(
2
)
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
- führt den Vorsitz des Verwaltungsrates, beruft die Sitzungen ein und leitet diese,
- sorgt für die ordnungsgemäße Protokollierung und Durchführung der Beschlüsse,
- ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der Geschäftsführung und stellvertretenden Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 2 VSA-G),
- ist die mittelbare Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 3 VSA-G),
- führt die Auflösung nach § 8 durch.
(
3
)
Die rechtliche Vertretung des Verwaltungszweckverbandes erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Die rechtliche Vertretung kann durch Geschäftsordnung auf die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes umfänglich oder teilweise übertragen werden.
#§ 6
Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes
Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt das Verwaltungs- und Serviceamt im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Beschlüsse des Verwaltungsrates. Sie ist Dienstvorgesetze und Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes.
#§ 7
Finanzierung
(
1
)
Soweit die Aufgabenerfüllung nicht zentral durch eine Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz finanziert wird, erfolgt die Finanzierung des Verwaltungszweckverbandes durch Umlagen oder Gebühren nach Maßgabe von § 14 VSA-G.
(
2
)
Im Falle der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 3 werden die Betriebskosten mit dem zuständigen kommunalen Träger abgerechnet sowie Elternbeiträge nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.
#§ 8
Auflösung
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband kann durch Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO aufgelöst oder mit einem anderen Verwaltungszweckverband zusammengelegt werden.
(
2
)
Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten im Verhältnis der in den letzten fünf Jahren geleisteten Umlagen oder Gebühren auf die einzelnen Verbandsmitglieder über, soweit nicht in der Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO anderes geregelt ist.
#§ 9
Übergangsvorschrift
Der Verwaltungsrat wird nach den Regelungen dieser Rechtsverordnung mit Beginn der Amtszeit der Ältestenkreise nach den allgemeinen Kirchenwahlen 2025 neu gebildet. Bis dahin besteht der Verwaltungsrat in der bisherigen Besetzung fort; insoweit gelten die Regelungen der in § 10 Abs. 2 genannten Rechtsverordnung fort.
#§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(
1
)
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(
2
)
Die Rechtsverordnung vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 128) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 7. April 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
#Anlage
1. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal
Bad Schönborn
Bahnbrücken
Bretten und Gölshausen
Diedelsheim
Dürrenbüchig
Flehingen
Gochsheim
Gondelsheim
Heidelsheim
Helmsheim
Jöhlingen
Kürnbach-Bauerbach
Menzingen
Münzesheim
Nußbaum-Sprantal
Oberacker
Oberöwisheim
Östringen-Odenheim
Philippsburg
Region Bruchsal
Rinklingen
Ruit
Sulzfeld
Ubstadt-Weiher
Unteröwisheim
Waghäusel
Wössingen
Zaisenhausen
Bahnbrücken
Bretten und Gölshausen
Diedelsheim
Dürrenbüchig
Flehingen
Gochsheim
Gondelsheim
Heidelsheim
Helmsheim
Jöhlingen
Kürnbach-Bauerbach
Menzingen
Münzesheim
Nußbaum-Sprantal
Oberacker
Oberöwisheim
Östringen-Odenheim
Philippsburg
Region Bruchsal
Rinklingen
Ruit
Sulzfeld
Ubstadt-Weiher
Unteröwisheim
Waghäusel
Wössingen
Zaisenhausen
2. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Badischer Enzkreis
Bauschlott
Dietlingen
Dürrn
Eisingen
Ellmendingen-Dietenhausen-Weiler
Göbrichen
Ispringen
Kieselbronn
Königsbach
Langenalb
Niefern
Nöttingen
Öschelbronn
Singen (Remchingen)
Stein
Wilferdingen
Dietlingen
Dürrn
Eisingen
Ellmendingen-Dietenhausen-Weiler
Göbrichen
Ispringen
Kieselbronn
Königsbach
Langenalb
Niefern
Nöttingen
Öschelbronn
Singen (Remchingen)
Stein
Wilferdingen
3. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Karlsruhe-Land
Berghausen-Wöschbach
Blankenloch
Eggenstein
Ettlingen
Graben-Neudorf
Friedrichstal
Hochstetten
Ittersbach
Karlsbad-Auerbach
Karlsbad-Spielberg
Kleinsteinbach
Langensteinbach
Leopoldshafen
Liedolsheim
Linkenheim
Malsch
Mutschelbach
Neureut-Kirchfeld
Neureut-Nord
Neureut-Süd
Pfinztal-Söllingen
Rheinstetten
Rußheim
Spöck
Staffort-Büchenau
Waldbronn
Weingarten
Blankenloch
Eggenstein
Ettlingen
Graben-Neudorf
Friedrichstal
Hochstetten
Ittersbach
Karlsbad-Auerbach
Karlsbad-Spielberg
Kleinsteinbach
Langensteinbach
Leopoldshafen
Liedolsheim
Linkenheim
Malsch
Mutschelbach
Neureut-Kirchfeld
Neureut-Nord
Neureut-Süd
Pfinztal-Söllingen
Rheinstetten
Rußheim
Spöck
Staffort-Büchenau
Waldbronn
Weingarten
Nr. 45Rechtsverordnung des Zweckverbandes Hochrhein-Südschwarzwald
(RVO Verwaltungszweckverband Hochrhein-Südschwarzwald – RVO-VzV-HochrSüdschw)
(RVO Verwaltungszweckverband Hochrhein-Südschwarzwald – RVO-VzV-HochrSüdschw)
Vom 7. April 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 107 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 19. April 2024 (GVBl., Nr. 70, S. 137), folgende Rechtsverordnung:
#§ 1
Name und Zweck
(
1
)
Zur Erledigung der Aufgaben ihrer Verwaltung bilden unter Fortführung des bisher bereits
bestehenden Verwaltungszweckverbandes
- der Evangelische Kirchenbezirk Hochrhein,
- der Evangelische Kirchenbezirk Markgräflerland und
- die in der Anlage näher aufgeführten evangelischen Kirchengemeinden der evangelischen Kirchenbezirke Hochrhein und Markgräflerland
einen Verwaltungszweckverband.
(
2
)
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet der Verwaltungszweckverband ein Verwaltungs- und Serviceamt ein.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband trägt den Namen
„Evangelischer Verwaltungszweckverband
Hochrhein-Südschwarzwald“
(
4
)
Der Verwaltungszweckverband hat seinen Sitz in Lörrach.
(
5
)
Das Verbandsgebiet umfasst den räumlichen Bereich der Evangelischen Kirchenbezirke Hochrhein und Markgräflerland.
#§ 2
Aufgaben des Verwaltungszweckverbandes
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband nimmt durch das Verwaltungs- und Serviceamt für seine Mitglieder Aufgaben nach dem Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz (VSA-G) wahr.
(
2
)
Für kirchliche Rechtsträger, die unter der Aufsicht der Landeskirche stehen oder die Mitglieder des Diakonischen Werks Baden sind, können aufgrund gesondert zu schließender Vereinbarungen weitergehende Leistungen erbracht werden. Leistungen an weitere Rechtsträger können erbracht werden, wenn der Verwaltungsrat dem zustimmt und der Evangelische Oberkirchenrat die Übernahme genehmigt. Satz 2 gilt nicht für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtsverordnung bereits bestehende Vertragsverhältnisse.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband kann die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen übernehmen.
(
4
)
Die Geschäftsverteilung im Verwaltungs- und Serviceamt kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
#§ 3
Verwaltungsrat
(
1
)
Organ des Verwaltungszweckverbandes ist der Verwaltungsrat. Durch diesen wird der Verwaltungszweckverband geleitet.
(
2
)
Der Verwaltungsrat ist zuständig für:
- Begleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes in wesentlichen Fragen der Umsetzung des VSA-G sowie bei grundlegenden strukturellen Veränderungen,
- Erlass einer Geschäftsordnung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis einer vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen Mustergeschäftsordnung,
- die Bestellung einer oder mehrerer Stellvertretungen für die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes im Benehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat (§ 12 Abs. 1 VSA-G),
- personal- und dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der Stellvertretungen der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes,
- Mitwirkung bei der Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Verwaltungs- und Serviceamtes nach § 12 Abs. 1 VSA-G,
- Mitwirkung beim Erlass einer Gebührenordnung oder Erlass einer Gebührenordnung nach Maßgabe von § 14 VSA-G,
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Verwaltungszweckverbandes,
- die Feststellung der Jahresrechnung,
- Wahl einer oder eines Verwaltungsratsvorsitzenden sowie der Stellvertretung nach § 5,
- Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung sowie Erteilung der Entlastung der Person im Vorsitzendenamt sowie der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis der geprüften Jahresrechnungen,
- Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat zur Änderung der Rechtsverordnung des Verwaltungszweckverbandes nach Beteiligung der Verbandsmitglieder.
(
3
)
Dem Verwaltungsrat gehören an:
- die Dekaninnen oder Dekane der beteiligten Kirchenbezirke,
- aus jedem Kirchenbezirk drei Personen, die von der Bezirkssynode des Kirchenbezirks aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder gewählt werden und die die Interessen der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk im Verwaltungsrat vertreten sollen. Die Personen sollen Mitglied eines Kirchengemeinderates einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks sein. Sie sollen Kompetenzen in wirtschaftlichen, rechtlichen oder personalwirtschaftlichen Fragestellungen besitzen. Die Bezirkssynode kann beschließen, die Zahl der von ihr zu wählenden Personen zu verringern.
(
4
)
Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 1 wird die Stellvertretung aufgrund einer Entscheidung des Bezirkskirchenrates durch die Dekanstellvertretung oder durch die Schuldekanin oder den Schuldekan wahrgenommen. Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 werden je Kirchenbezirk zwei Personen als 1. und 2. Stellvertretung durch die Bezirkssynode gewählt.
(
5
)
Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 und die Stellvertretungen werden für die Dauer der Wahlperiode der Ältestenkreise bestellt. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu entsenden.
(
6
)
Die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes ist beratendes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht. Weitere beratende Mitglieder können nicht bestellt werden. Zur Erörterung spezifischer Fragestellungen können Personen beratend für einzelne Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden. Die Stellvertretungen der Geschäftsführung können im Einvernehmen mit der Geschäftsführung vom Verwaltungsrat ständig oder zeitweise beratend hinzugezogen werden.
#§ 4
Sitzungen des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wird schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte von der oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Die Sitzungen können nach den Regelungen der Digitalsitzungs-RVO digital durchgeführt werden.
(
2
)
Für die Sitzungen gelten § 13 Leitungs- und Wahlgesetz sowie die Artikel 108 bis 111 der Grundordnung entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
(
3
)
Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal jährlich. In dringenden Fällen kann der Verwaltungsrat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats dies unter Angabe der Gründe schriftlich beantragt.
#§ 5
Vorsitz des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode des Verwaltungsrats aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.
(
2
)
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
- führt den Vorsitz des Verwaltungsrates, beruft die Sitzungen ein und leitet diese,
- sorgt für die ordnungsgemäße Protokollierung und Durchführung der Beschlüsse,
- ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der Geschäftsführung und stellvertretenden Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 2 VSA-G),
- ist die mittelbare Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 3 VSA-G),
- führt die Auflösung nach § 8 durch.
(
3
)
Die rechtliche Vertretung des Verwaltungszweckverbandes erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Die rechtliche Vertretung kann durch Geschäftsordnung auf die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes umfänglich oder teilweise übertragen werden.
#§ 6
Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes
Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt das Verwaltungs- und Serviceamt im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Beschlüsse des Verwaltungsrates. Sie ist Dienstvorgesetze und Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes.
#§ 7
Finanzierung
(
1
)
Soweit die Aufgabenerfüllung nicht zentral durch eine Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz finanziert wird, erfolgt die Finanzierung des Verwaltungszweckverbandes durch Umlagen oder Gebühren nach Maßgabe von § 14 VSA-G.
(
2
)
Im Falle der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 3 werden die Betriebskosten mit dem zuständigen kommunalen Träger abgerechnet sowie Elternbeiträge nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.
#§ 8
Auflösung
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband kann durch Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO aufgelöst oder mit einem anderen Verwaltungszweckverband zusammengelegt werden.
(
2
)
Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten im Verhältnis der in den letzten fünf Jahren geleisteten Umlagen oder Gebühren auf die einzelnen Verbandsmitglieder über, soweit nicht in der Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO anderes geregelt ist.
#§ 9
Übergangsvorschrift
Der Verwaltungsrat wird nach den Regelungen dieser Rechtsverordnung mit Beginn der Amtszeit der Ältestenkreise nach den allgemeinen Kirchenwahlen 2025 neu gebildet. Bis dahin besteht der Verwaltungsrat in der bisherigen Besetzung fort; insoweit gelten die Regelungen der in § 10 Abs. 2 genannten Rechtsverordnung fort.,
#§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(
1
)
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(
2
)
Die Rechtsverordnung vom 2. März 2004 (GVBl. S. 53) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 7. April 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
#Anlage
1. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Kirchenbezirk Hochrhein
Albbruck-Görwihl
Bad Säckingen
Bonndorf
Höchenschwand-Häusern
Jestetten
Kadelburg
Klettgau
Lauchringen
Laufenburg
Murg-Rickenbach-Herrischried
Sankt Blasien
Tiengen
Todtmoos
Waldshut
Wehr und Öflingen
Wutachtal
Bad Säckingen
Bonndorf
Höchenschwand-Häusern
Jestetten
Kadelburg
Klettgau
Lauchringen
Laufenburg
Murg-Rickenbach-Herrischried
Sankt Blasien
Tiengen
Todtmoos
Waldshut
Wehr und Öflingen
Wutachtal
2. Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Kirchenbezirk Markgräflerland
Am Blauen
An der Kleinen Wiese
Bad Bellingen
Binzen-Rümmingen
Blansingen-Kleinkems-Welmlingen
Brombach
Dossenbach
Efringen-Kirchen
Egringen-Mappach-Winterweiler
Eimeldingen-Märkt
Fahrnau
Feuerbach
Fischingen
Gersbach
Grenzach
Haltingen
Hasel
Hauingen
Hausen
Hertingen
Kandern
Lörrach
Maulburg
Ötlingen
Rheinfelden
Riedlingen
Rötteln
Schallbach
Schönau (Markgräflerland)
Schopfheim
Steinen
Tannenkirch
Todtnau
Tüllingen
Weil am Rhein
Wittlingen
Wollbach-Holzen
Whylen
Zell im Wiesental
An der Kleinen Wiese
Bad Bellingen
Binzen-Rümmingen
Blansingen-Kleinkems-Welmlingen
Brombach
Dossenbach
Efringen-Kirchen
Egringen-Mappach-Winterweiler
Eimeldingen-Märkt
Fahrnau
Feuerbach
Fischingen
Gersbach
Grenzach
Haltingen
Hasel
Hauingen
Hausen
Hertingen
Kandern
Lörrach
Maulburg
Ötlingen
Rheinfelden
Riedlingen
Rötteln
Schallbach
Schönau (Markgräflerland)
Schopfheim
Steinen
Tannenkirch
Todtnau
Tüllingen
Weil am Rhein
Wittlingen
Wollbach-Holzen
Whylen
Zell im Wiesental
Nr. 46Rechtsverordnung des Zweckverbandes Baden-Baden und Rastatt
(RVO Verwaltungszweckverband Baden-Baden und Rastatt – RVO-VzV-BaBaRa)
(RVO Verwaltungszweckverband Baden-Baden und Rastatt – RVO-VzV-BaBaRa)
Vom 7. April 2025
####Der Landeskirchenrat erlässt nach Artikel 107 Abs. 3 der Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 29. April 2024 (GVBl., Nr. 70, S. 137), folgende Rechtsverordnung:
#§ 1
Name und Zweck
(
1
)
Zur Erledigung der Aufgaben ihrer Verwaltung bilden unter Fortführung des bisher bereits bestehenden Verwaltungszweckverbandes der Evangelische Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt sowie die in der Anlage näher aufgeführten Kirchengemeinden des Kirchenbezirks einen Verwaltungszweckverband.
(
2
)
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben richtet der Verwaltungszweckverband ein Verwaltungs- und Serviceamt ein.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband trägt den Namen
„Evangelischer Verwaltungszweckverband
Baden-Baden und Rastatt“
(
4
)
Der Verwaltungszweckverband hat seinen Sitz in Baden-Baden.
(
5
)
Das Verbandsgebiet umfasst den räumlichen Bereich des Evangelischen Kirchenbezirkes Baden-Baden und Rastatt abzüglich des räumlichen Bereiches der Kirchengemeinden Lichtenau und Scherzheim.
#§ 2
Aufgaben des Verwaltungszweckverbandes
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband nimmt durch das Verwaltungs- und Serviceamt für seine Mitglieder Aufgaben nach dem Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz (VSA-G) wahr.
(
2
)
Für kirchliche Rechtsträger, die unter der Aufsicht der Landeskirche stehen oder die Mitglieder des Diakonischen Werks Baden sind, können aufgrund gesondert zu schließender Vereinbarungen weitergehende Leistungen erbracht werden. Leistungen an weitere Rechtsträger können erbracht werden, wenn der Verwaltungsrat dem zustimmt und der Evangelische Oberkirchenrat die Übernahme genehmigt.
(
3
)
Der Verwaltungszweckverband kann die Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen übernehmen.
(
4
)
Die Geschäftsverteilung im Verwaltungs- und Serviceamt kann in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
#§ 3
Verwaltungsrat
(
1
)
Organ des Verwaltungszweckverbandes ist der Verwaltungsrat. Durch diesen wird der Verwaltungszweckverband geleitet.
(
2
)
Der Verwaltungsrat ist zuständig für:
- Begleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes in wesentlichen Fragen der Umsetzung des VSA-G sowie bei grundlegenden strukturellen Veränderungen,
- Erlass einer Geschäftsordnung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis einer vom Evangelischen Oberkirchenrat herausgegebenen Mustergeschäftsordnung,
- die Bestellung einer oder mehrerer Stellvertretungen für die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes im Benehmen mit dem Evangelischen Oberkirchenrat (§ 12 Abs. 1 VSA-G),
- personal- und dienstrechtliche Entscheidungen bezüglich der Stellvertretungen der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes,
- Mitwirkung bei der Bestellung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers des Verwaltungs- und Serviceamtes nach § 12 Abs. 1 VSA-G,
- Mitwirkung beim Erlass einer Gebührenordnung oder Erlass einer Gebührenordnung nach Maßgabe von § 14 VSA-G,
- Beschlussfassung über den Haushaltsplan des Verwaltungszweckverbandes,
- die Feststellung der Jahresrechnung,
- Wahl einer oder eines Verwaltungsratsvorsitzenden sowie der Stellvertretung nach § 5,
- Entgegennahme des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung sowie Erteilung der Entlastung der Person im Vorsitzendenamt sowie der Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes auf Basis der geprüften Jahresrechnungen,
- Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat zur Änderung der Rechtsverordnung des Verwaltungszweckverbandes nach Beteiligung der Verbandsmitglieder,
- die regelmäßige Information der Verbandsmitglieder über die Tätigkeit des Verbandes.
(
3
)
Dem Verwaltungsrat gehören an:
- die Dekanin oder der Dekan des Kirchenbezirks,
- aus dem Kirchenbezirk vier Personen, die von der Bezirkssynode des Kirchenbezirks aus der Mitte ihrer stimmberechtigten Mitglieder gewählt werden und die die Interessen der Kirchengemeinden im Kirchenbezirk im Verwaltungsrat vertreten sollen. Die Personen sollen Mitglied eines Kirchengemeinderates einer Kirchengemeinde des Kirchenbezirks sein. Sie sollen Kompetenzen in wirtschaftlichen, rechtlichen oder personalwirtschaftlichen Fragestellungen besitzen. Die Bezirkssynode kann beschließen, die Zahl der von ihr zu wählenden Personen zu verringern.
(
4
)
Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 1 wird die Stellvertretung aufgrund einer Entscheidung des Bezirkskirchenrates durch die Dekanstellvertretung oder durch die Schuldekanin oder den Schuldekan wahrgenommen. Für die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 werden je Kirchenbezirk zwei Personen als 1. und 2. Stellvertretung durch die Bezirkssynode gewählt.
(
5
)
Die Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 und die Stellvertretungen werden für die Dauer der Wahlperiode der Ältestenkreise bestellt. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, ist eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger zu entsenden.
(
6
)
Die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes ist beratendes Mitglied des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht. Weitere beratende Mitglieder können nicht bestellt werden. Zur Erörterung spezifischer Fragestellungen können Personen beratend für einzelne Tagesordnungspunkte hinzugezogen werden. Die Stellvertretungen der Geschäftsführung können im Einvernehmen mit der Geschäftsführung vom Verwaltungsrat ständig oder zeitweise beratend hinzugezogen werden.
#§ 4
Sitzungen des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wird schriftlich unter Angabe der Tagesordnungspunkte von der oder dem Verwaltungsratsvorsitzenden einberufen. Die Sitzungen können nach den Regelungen der Digitalsitzungs-RVO digital durchgeführt werden.
(
2
)
Für die Sitzungen gelten § 13 Leitungs- und Wahlgesetz sowie die Artikel 108 bis 111 der Grundordnung entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist.
(
3
)
Der Verwaltungsrat tagt mindestens einmal jährlich. In dringenden Fällen kann der Verwaltungsrat ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände einberufen werden. Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrats dies unter Angabe der Gründe schriftlich beantragt.
#§ 5
Vorsitz des Verwaltungsrates
(
1
)
Der Verwaltungsrat wählt für die Dauer der Wahlperiode des Verwaltungsrats aus seiner Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter.
(
2
)
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
- führt den Vorsitz des Verwaltungsrates, beruft die Sitzungen ein und leitet diese,
- sorgt für die ordnungsgemäße Protokollierung und Durchführung der Beschlüsse,
- ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter der Geschäftsführung und stellvertretenden Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes (§ 12 Abs. 2 VSA-G),
- ist die mittelbare Dienstaufsicht für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Service-amtes (§ 12 Abs. 3 VSA-G),
- führt die Auflösung nach § 8 durch.
(
3
)
Die rechtliche Vertretung des Verwaltungszweckverbandes erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Die rechtliche Vertretung kann durch Geschäftsordnung auf die Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes umfänglich oder teilweise übertragen werden.
#§ 6
Geschäftsführung des Verwaltungs- und Serviceamtes
Die Geschäftsführung erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und vertritt das Verwaltungs- und Serviceamt im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Beschlüsse des Verwaltungsrates. Sie ist Dienstvorgesetze und Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Serviceamtes.
#§ 7
Finanzierung
(
1
)
Soweit die Aufgabenerfüllung nicht zentral durch eine Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz finanziert wird, erfolgt die Finanzierung des Verwaltungszweckverbandes durch Umlagen oder Gebühren nach Maßgabe von § 14 VSA-G.
(
2
)
Im Falle der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung im Sinne von § 2 Abs. 3 werden die Betriebskosten mit dem zuständigen kommunalen Träger abgerechnet sowie Elternbeiträge nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.
#§ 8
Auflösung
(
1
)
Der Verwaltungszweckverband kann durch Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO aufgelöst oder mit einem anderen Verwaltungszweckverband zusammengelegt werden.
(
2
)
Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten im Verhältnis der in den letzten fünf Jahren geleisteten Umlagen oder Gebühren auf die einzelnen Verbandsmitglieder über, soweit nicht in der Rechtsverordnung nach Artikel 107 GO anderes geregelt ist.
#§ 9
Übergangsvorschrift
Der Verwaltungsrat wird nach den Regelungen dieser Rechtsverordnung mit Beginn der Amtszeit der Ältestenkreise nach den allgemeinen Kirchenwahlen 2025 neu gebildet. Bis dahin besteht der Verwaltungsrat in der bisherigen Besetzung fort; insoweit gelten die Regelungen der in § 10 Abs. 2 genannten Rechtsverordnung fort.
#§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(
1
)
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.
(
2
)
Die Rechtsverordnung vom 23. Oktober 2002 (GVBl. 2003, S. 85) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft.
__________________________________
Karlsruhe, den 7. April 2025
Der Landeskirchenrat
Prof. Dr. Heike Springhart
Landesbischöfin
#Anlage
Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt
Baden-Baden
Bietigheim-Muggensturm-Ötigheim
Bühl
Bühlertal
Durmersheim
Forbach-Weisenbach
Gernsbach
Gaggenau
Iffezheim
Kuppenheim-Bischweier
Rastatt
Bietigheim-Muggensturm-Ötigheim
Bühl
Bühlertal
Durmersheim
Forbach-Weisenbach
Gernsbach
Gaggenau
Iffezheim
Kuppenheim-Bischweier
Rastatt
Ordnungen
Nr. 47Studien- und Prüfungsordnung
der Evangelischen Hochschule Freiburg
für die Bachelorstudiengänge
Religionspädagogik/Gemeindediakonie,
Soziale Arbeit und
Kindheitspädagogik
der Evangelischen Hochschule Freiburg
für die Bachelorstudiengänge
Religionspädagogik/Gemeindediakonie,
Soziale Arbeit und
Kindheitspädagogik
Vom 27. November 2012
in der Fassung vom 30. Januar 2025
####in der Fassung vom 30. Januar 2025
Gemäß § 10 des Kirchlichen Gesetzes über die Evangelische Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 24. April 2010, zuletzt geändert am 21. Oktober 2020 (GVBl. 2021, Teil I, S. 34) in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Nr. 12 der Rechtsverordnung über die Verfassung der Evangelischen Hochschule Freiburg vom 21. Juli 2021 erlässt der Senat der Evangelischen Hochschule der Evangelischen Landeskirche in Baden folgende Satzung:
#Inhaltsübersicht
#A. Allgemeiner Teil
#I. Allgemeines
§ 1 | Geltungsbereich |
§ 2 | Immatrikulationsvoraussetzungen |
§ 3 | Studienberatung |
II. Organisation und Zuständigkeiten in Prüfungsangelegenheiten
§ 4 | Prüfungsamt |
§ 5 | Gemeinsamer Prüfungsausschuss, Zentraler Prüfungsausschuss |
§ 6 | Zuständigkeiten des Prüfungsamtes |
III. Prüfende
§ 7 | Prüfungsamt |
IV. Prüfungsleistungen
§ 8 | Art der Prüfungsleistungen |
§ 9 | Mündliche Prüfungsleistungen |
§ 10 | Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten und besondere Verfahren |
§ 11 | Lehrproben |
§ 12 | Bewertung der Prüfungsleistungen |
§ 13 | Regelstudium, Studienaufbau und ECTS |
§ 14 | Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß |
§ 15 | Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen |
§ 16 | Wiederholung von Modulprüfungen |
§ 17 | Einsicht in die Prüfungsakten |
§ 18 | Anerkennung und Anrechnung von Leistungen |
§ 19 | Schutzbestimmungen bei Mutterschutz, Elternzeit und besonderen Lebenslagen |
V. Prüfungen
§ 20 | Prüfungsaufbau |
§ 21 | Verlust der Zulassung zum Studiengang und des Prüfungsanspruchs, Fristen |
§ 22 | Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen |
§ 23 | Fachliche Voraussetzungen |
VI. Bachlorprüfung
§ 24 | Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung |
§ 25 | Fachliche Voraussetzungen |
§ 26 | Art und Umfang der Bachelorprüfung |
§ 27 | Ausgabe und Bearbeitungszeit der Bachelorthesis |
§ 28 | Abgabe und Bewertung der Bachelorthesis |
§ 29 | Zusatzmodule |
§ 30 | Bildung der Gesamtnote, Prüfungszeugnis |
§ 31 | Bachelorgrad und Bachelorurkunde |
§ 32 | Ungültigkeit der Bachelorprüfung |
VII. Experimentierklausel
§ 33 | Experimentierklausel |
I. Bachelorstudiengang Religionspädagogik/Gemeindediakonie
#B. Besonderer Teil
§ 34 | Regelstudienzeit |
§ 35 | Studienaufbau und Stundenumfang |
§ 36 | Praktisches Studiensemester |
§ 37 | Studienziel |
§ 38 | Bestandteile des Studienganges |
§ 39 | Berufsintegrierendes Studium |
§ 40 | Studienaufbau und Prüfungen |
§ 41 | Berechnung der Noten der Module und der Bachelorprüfung |
II. Bachlorstudiengang Soziale Arbeit
§ 42 | Regelstudienzeit |
§ 43 | Studienaufbau und Stundenumfang |
§ 44 | Praktisches Studiensemester |
§ 45 | Studienziel |
§ 46 | Bestandteile des Studienganges |
§ 47 | Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen |
§ 48 | Studienaufbau und Prüfungen |
§ 49 | Berechnung der Noten der Module und der Bachelorprüfung |
III. Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik
§ 50 | Regelstudienzeit |
§ 51 | Studienaufbau und Stundenumfang |
§ 52 | Praktika |
§ 53 | Studienziel |
§ 54 | Bestandteile des Studienganges |
§ 55 | Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen |
§ 56 | Studienaufbau und Prüfungen |
§ 57 | Berechnung der Gesamtnote |
C. Schlussbestimmungen
§ 58 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen |
A. Allgemeiner Teil
#I. Allgemeines
#§ 1
Geltungsbereich
Diese Studien- und Prüfungsordnung gilt für die folgenden Bachelorstudiengänge der Evangelischen Hochschule Freiburg (im Folgenden: Hochschule):
- Religionspädagogik/Gemeindediakonie,
- Soziale Arbeit und
- Kindheitspädagogik.
§ 2
Immatrikulationsvoraussetzungen
(
1
)
Zu den Studiengängen nach § 1 kann eingeschrieben werden, wer die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium nach § 58 Landeshochschulgesetz (LHG) erfüllt und im Rahmen des hochschuleigenen Zulassungsverfahrens eine Zulassung erhalten hat. Näheres regelt die Hochschule in einer Zulassungs- und Immatrikulationsordnung und gegebenenfalls in weiteren, studiengangsspezifischen Zulassungsregelungen.
(
2
)
Die Organisation des Zulassungs- und Auswahlverfahrens obliegt dem Bewerbungsamt der Hochschule.
(
3
)
Die Immatrikulation an der Hochschule ist ferner abhängig von der Entrichtung einer Verwaltungsgebühr, des Beitrags für das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald sowie der vertraglich vereinbarten Studienentgelte. Das Nähere bestimmt die Gebührenregelung der Hochschule (§ 12 EH-G). Über die Zahlung der Studienentgelte für die Teilnahme am Studiengang ist mit der bzw. dem Studierenden eine schriftliche privatrechtliche Vereinbarung zu treffen.
(
4
)
Es kann die Zulassung in ein Vollzeitstudium oder ein Teilzeitstudium beantragt werden, sofern ein Teilzeitstudium in den Studiengängen nach § 1 angeboten wird. Mit Zustimmung des Prüfungsamtes (§ 4) ist ein Wechsel zwischen Vollzeit- und Teilzeitstudium (und umgekehrt) möglich.
#§ 3
Studienberatung
(
1
)
Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch das Studierendensekretariat. Die fachliche Studienberatung erfolgt durch die Lehrenden der beteiligten Fachbereiche und durch die jeweilige Studiengangsleitung.
(
2
)
Für Studierende mit Behinderung/chronischen Krankheiten sowie für Gleichstellungsfragen stehen den Studierenden für eine spezielle Studienberatung die Beauftragte bzw. der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen/chronischen Krankheiten und die Gleichstellungsbeauftragte bzw. der Gleichstellungsbeauftragte zur Verfügung.
#II. Organisation und Zuständigkeiten in Prüfungsangelegenheiten
#§ 4
Prüfungsamt
(
1
)
Für die administrative Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen und zur Unterstützung des Gemeinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) ist an der Hochschule ein Prüfungsamt eingerichtet.
(
2
)
Es ist insbesondere zuständig für
- die Organisation der Prüfungen,
- die Bearbeitung von Anträgen Studierender in Prüfungsangelegenheiten,
- die Genehmigung von individuellen Studienverlaufsplänen,
- die Beratung der Studierenden in prüfungsrechtlichen Fragen,
- die Ausstellung der Zeugnisse und Urkunden (§§ 30 und 31) sowie
- die Koordination der Prüfungsangelegenheiten.
(
3
)
Die Rektorin bzw. der Rektor bestellt eine Professorin bzw. einen Professor als die Leiterin bzw. den Leiter des Prüfungsamtes für vier Jahre. Erneute Bestellung ist zulässig.
#§ 5
Gemeinsamer Prüfungsausschuss, Beschwerdeausschuss
(
1
)
Für die Organisation von Bachelorprüfungen sowie die durch diese Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der Gemeinsame Prüfungsausschuss der Hochschule zuständig.
(
2
)
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss hat sieben Mitglieder. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre. Erneute Bestellung ist zulässig.
(
3
)
Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3) hat von Amts wegen den Vorsitz inne. Die Dekaninnen bzw. Dekane der Fachbereiche, denen die in § 1 genannten Studiengänge zugeordnet sind, sind von Amts wegen Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. Die Stellvertretung der bzw. des Vorsitzenden rotiert zwischen den Mitgliedern des Gemeinsamen Prüfungsausschusses. Die weiteren Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses werden von der Rektorin bzw. dem Rektor aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren bestellt. Andere Professorinnen und Professoren, Lehrbeauftragte sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben und Mitarbeitende des Prüfungsamtes können beratend hinzugezogen werden. Die Leitung des Prüfungsamtes führt die Geschäfte des Gemeinsamen Prüfungsausschusses.
(
4
)
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Studien- und Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig den beteiligten Fachbereichen über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten. Im Bedarfsfall berichtet er über die tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelorthesis sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. Der Gemeinsame Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform des Studienplans und der Studien- und Prüfungsordnung.
(
5
)
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann die ihm obliegenden Aufgaben auf das Prüfungsamt übertragen.
(
6
)
Zu den Aufgaben des Gemeinsamen Prüfungsausschusses gehören insbesondere:
- Entscheidungen bezogen auf eine koordinierte Organisation von Modulprüfungen,
- Entscheidungen zur Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung der Studien- und Prüfungsordnung an der Hochschule,
- Entscheidungen über eine zweite Wiederholung (§ 16) und über das Erlöschen des Prüfungsanspruches und der Zulassung zum Studium gem. § 21 sowie gem. § 32 Abs. 5 Satz 4 LHG,
- Entscheidungen über die Anerkennung von Studienleistungen und Studienzeiten, die an anderen Hochschulen erbracht wurden gem. § 18,
- Entscheidungen über die Anrechnung von außerhalb eines Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten,
- Entscheidungen über die Verlängerung von Bearbeitungszeiten und Abweichungen von festgelegten Formen von Prüfungsleistungen und
- Entscheidungen bei Täuschung oder Ordnungsverstoß gem. § 14.
(
7
)
Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen.
(
8
)
Die Mitglieder des Gemeinsamen Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit (Art. 111 Abs. 1 Grundordnung). Sofern sie nicht in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zur Landeskirche stehen, sind sie durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Gemeinsamen Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Eine von den Verpflichteten unterschriebene Verpflichtungserklärung ist zu den Akten der Hochschule zu nehmen.
(
9
)
An der Hochschule besteht ein Beschwerdeausschuss. Ihm obliegt die Entscheidung über Rechtsbehelfe in prüfungsrechtlichen Angelegenheiten an der Hochschule. Seine Mitglieder sind:
- die bzw. der von der Rektorin bzw. dem Rektor bestimmte Vorsitzende,
- die Rektorin bzw. der Rektor,
- die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).
§ 6
Zuständigkeiten des Prüfungsamtes
Die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes ist zuständig für die Entscheidung
- über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (§ 14),
- über das Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen (§ 15),
- über die Bestellung der Prüfenden (§ 7),
- über die Bearbeitung einer Bachelorthesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule (§ 27 Abs. 3) und
- über die Verlängerung der Bearbeitungszeit von Leistungsnachweisen sowie der Bachelorthesis (§ 10 Abs. 10, § 27 Abs. 6).
III. Prüfende
#§ 7
Prüfende
(
1
)
Zu Prüferinnen und Prüfern können neben Professorinnen und Professoren auch Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Prüfer oder Prüferin ist in der Regel, wer eine der jeweiligen Prüfungs- oder Studienleistung zugrundeliegende Lehrveranstaltung im betreffenden Semester hauptverantwortlich durchgeführt hat. Bei der Bachelorthesis muss eine bzw. einer der prüfenden Professorin bzw. Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen Aufgaben sein.
(
2
)
Die zu prüfende Person kann für die Bachelorthesis und die mündlichen Prüfungen die Prüfende bzw. den Prüfenden oder eine Gruppe von Prüfenden vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch auf Bestellung der vorgeschlagenen Personen.
(
3
)
Die Namen der Prüfenden sollen den zu prüfenden Personen rechtzeitig bekannt gegeben werden.
(
4
)
Für die Prüfenden gilt die Regelung zur Verschwiegenheit in § 5 Abs. 8 Satz 2 entsprechend.
#IV. Studien- und Prüfungsleistungen
#§ 8
Art der Prüfungsleistungen
(
1
)
Im Rahmen des Studiums werden gemäß Modulhandbuch und SPO Besonderer Teil benotete Prüfungsleistungen (PL) und unbenotete Prüfungsvorleistungen (PVL) erbracht.
(
2
)
Alle Lehrveranstaltungen, für die weder Prüfungsleistung noch Prüfungsvorleistung im Modulhandbuch vorgesehen sind, werden mit einer Studienleistung (SL) (bestanden/nichtbestanden) absolviert.
(
3
)
Folgende im Modulhandbuch aufgeführte Lehrveranstaltungsformen erfordern ihrem Wesen nach sowie zur Sicherung und Überprüfung des Kompetenzerwerbs Anwesenheit (studentische Anwesenheitspflicht):
• Werkstatt,
• Praktische Übungen,
• Exkursion,
• Praktikum.
Der Senat entscheidet auf Vorschlag des Fachbereichs über die Zuordnung von Lehrveranstaltungen zu den genannten Kategorien. In einer anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltung müssen die Praxisanteile überwiegen.
(
4
)
Für als präsenzpflichtig definierte Lehrveranstaltungen gilt folgende Anwesenheitsregelung: Die studentische Anwesenheitspflicht an einer Lehrveranstaltung ist erfüllt, wenn die studierende Person mindestens 80 % der für die Lehrveranstaltung vorgesehenen Semesterwochenstunden anwesend war. Aus triftigen Gründen, insbesondere aufgrund einer Behinderung, einer chronischen oder einer akuten Krankheit, einer Schwangerschaft, der Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter bis zu 14 Jahren oder der Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im Sinne des Pflegezeitgesetzes kann bei Vorlage entsprechender Nachweise eine Anwesenheit von 50 % genügen, wenn der Kompetenzerwerb im Rahmen einer Nacharbeit des verpassten Inhalts sichergestellt wird. Wird die notwendige Mindeststundenzahl an Präsenz im Sinne der Sätze 1 und 2 dieses Absatzes nicht erreicht, gilt die Lehrveranstaltung als nicht bestanden, es sei denn, es liegen triftige Gründe für die Nichtteilnahme vor, die die studierende Person nicht zu vertreten hat. Liegt ein triftiger Grund vor, gilt die Lehrveranstaltung als nicht belegt und kann zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederholt werden. Der Nachweis über die Fehlzeiten erfolgt durch die Dozierenden.
(
5
)
Prüfungs- oder Studienleistungen können
- mündlich (§ 9)
- schriftlich durch Klausurarbeiten (§ 10),
- durch sonstige schriftliche Arbeiten (§ 10)
- durch „kurstypische Verfahren“ (§ 10) und / oder
- durch Lehrproben (§ 11)
erbracht werden.
#§ 9
Mündliche Prüfungs- oder Studienleistungen
(
1
)
Durch mündliche Prüfungsleistungen sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über ein breites Grundlagenwissen verfügen.
(
2
)
Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfenden (Kollegialprüfung) oder vor einer Prüferin bzw. einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt.
(
3
)
Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung beträgt für jede zu prüfende Person 20 Minuten vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in Abschnitt B - Besonderer Teil.
(
4
)
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist den geprüften Personen jeweils im Anschluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben.
(
5
)
Studierende, die sich beim nächsten Prüfungstermin der gleichen Modulprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende zugelassen werden, es sei denn, eine zu prüfende Person widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse.
#§ 10
Klausurarbeiten, sonstige schriftliche Arbeiten und kurstypische Verfahren
(
1
)
In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden unter Aufsicht nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten können. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über notwendiges Grundlagenwissen verfügen. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.
(
2
)
Die Dauer der Klausurarbeiten wird in Abschnitt B - Besonderer Teil festgelegt. Klausuren dauern mindestens 60 und höchstens 240 Minuten.
(
3
)
In den sonstigen schriftlichen Arbeiten sollen die Studierenden nachweisen, dass sie mit den gängigen Methoden ihres Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten können. Es können Themen zur Auswahl gestellt werden.
(
4
)
Gegenstand sowohl von Hausarbeit als auch Referat ist die systematische, wissenschaftliche Erarbeitung eines fachspezifischen Themas.
(
5
)
Bewertungsgrundlage für eine Hausarbeit ist ausschließlich eine schriftliche Ausarbeitung.
(
6
)
Referate sind entweder (1) mündliche oder (2) schriftliche oder (3) mündliche und schriftliche Leistungsnachweise. Für (3) teilen Lehrende zu Beginn der LV mit, ob und in welchem Verhältnis der mündliche Teil bewertet wird.
(
7
)
Der Umfang der sonstigen schriftlichen Arbeiten wird auf Vorschlag der Dekanate vom Senat beschlossen und vom Prüfungsamt in angemessener Weise kommuniziert (Leitlinien).
(
8
)
Kurstypische Verfahren im Sinne dieser SPO sind die in den Modulhandbüchern festgelegten „kurstypischen Arbeiten“ und „besonderen Verfahren“. Die genaue Form der kurstypischen Arbeit oder des besonderen Verfahrens muss von den Modulverantwortlichen jeweils definiert und zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben werden. Auch die Kriterien der Bewertung und die sonstigen Anforderungen (Bearbeitungsdauer, Umfang etc.) müssen zeitgleich bekannt gemacht werden. Der Bearbeitungsaufwand muss sich an der im Modulhandbuch hinterlegten ECTS-Punktzahl orientieren und darf den inhaltlichen und zeitlichen Umfang einer vergleichbaren mündlichen oder schriftlichen Prüfungs- oder Studienleistung nach §§ 9 bis 11 nicht überschreiten.
Kurstypische Verfahren ermöglichen spezifische und gezielte Leistungsüberprüfungen in praxisorientierten Lehrveranstaltungen. Kurstypische Arbeiten oder besondere Verfahren können insbesondere sein: Portfolios, Projekt- und Forschungsberichte, Protokolle, Durchführung von praktischen Übungen und Präsentationen sowie deren Reflexion und Ausarbeitung, Lern- und Forschungstagebücher oder Fallarbeiten.
(
9
)
Das Bewertungsverfahren für die Leistungsnachweise unter §10 soll acht Wochen nicht überschreiten.
(
10
)
Soweit dies zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, die von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit der Klausurarbeiten nach Absatz 1 um einen den Umständen angemessenen Zeitraum verlängert werden. Bei sonstigen schriftlichen Arbeiten nach Absatz 3 kann die Frist für die Abgabe um höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung darüber trifft die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6).
#§ 11
Lehrproben
(
1
)
In den Lehrproben sollen die Studierenden nachweisen, dass sie über die entsprechenden Kompetenzen für die Unterrichts- und Lehrfähigkeit verfügen.
(
2
)
Eine Lehrprobe besteht aus drei Teilbereichen:
- einem schriftlichen Entwurf der zu haltenden Unterrichtsstunde,
- der Durchführung einer Unterrichtsstunde von 45-90 Minuten Dauer und
- einem Auswertungsgespräch über die gehaltene Unterrichtsstunde.
Die Leistungen zu 1. und 2. werden je zu 50% gewertet.
(
3
)
Die Lehrprobe wird vor einem Prüfer oder einer Prüferin und mindestens einem oder einer Beisitzenden abgelegt.
#§ 12
Bewertung der Prüfungsleistungen
(
1
)
Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
1 = sehr gut | = eine hervorragende Leistung |
2 = gut | = eine Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt liegt |
3 = befriedigend | = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht |
4 = ausreichend | = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt |
5 = nicht ausreichend | = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt |
Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen oder Prüfern bewertet, errechnet sich die Note aus dem Durchschnitt der festgesetzten Noten.
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen werden die einzelnen Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt. Demnach zulässige Zwischenwerte sind: 1.0, 1.3, 1.7, 2.0, 2.3, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0, 5.0.
(
2
)
Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Eine Gewichtung ist möglich und im Modulhandbuch sowie der SPO – Besonderer Teil – anzuzeigen. Die Note für die Bachelorthesis errechnet sich aus dem Durchschnitt der Noten der beiden Prüfenden. Die Modulnoten lauten bei einem Durchschnitt von:
- 1,00 bis 1,49: „sehr gut“;
- 1,50 bis 2,49: „gut“;
- 2,50 bis 3,49: „befriedigend“;
- 3,50 bis 4,00: „ausreichend“;
- über 4,00: „nicht ausreichend“.
§ 15 Abs. 1 S. 2 bleibt unberührt.
(
3
)
Für die Bildung der Gesamtnote (§ 30) gilt Absatz 2 entsprechend.
(
4
)
Bei der Durchschnittsbildung werden nur die ersten beiden Dezimalstellen hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(
5
)
Die Gesamtnote wird auf Antrag ergänzt durch die ECTS-Note, die gemäß ECTS-Standards dokumentiert wird.
#§ 13
Regelstudienzeit, Studienaufbau und ECTS
(
1
)
Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester und in Teilzeit bis zu 14 Semester. Das Studium umfasst praktische Studienzeiten in Form von Praktika oder eines integrierten Praktischen Studiensemesters sowie die Prüfungen einschließlich der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Im Rahmen der SPO – Besonderer Teil – werden Regeln über die Reihenfolge der Module und die zugehörigen Prüfungen erlassen.
(
2
)
Das Studium gliedert sich in Module, für die nach bestandener Modulprüfung bzw. nach Bestehen der Modulteilprüfungen die dem jeweiligen Modul zugeordneten ECTS-Punkte vergeben werden. ECTS-Punkte für ein Modul werden in der Regel erst erworben, wenn alle im Besonderen Teil der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch vorgeschrieben Studien- und Prüfungsleistungen für das Modul erfolgreich absolviert wurden. Die Module umfassen inhaltlich zusammenhängende Lehrveranstaltungen.
Sofern sich Module über mehrere Semester erstrecken, werden die vorgesehenen ECTS-Punkte semesterweise erworben.
(
3
)
Entsprechend dem Aufwand der Studierenden für die Lehrveranstaltungen, Vor- und Nacharbeit, Prüfungsvorbereitung und Prüfungen werden für die Module ECTS-Punkte (Credit-Points) entsprechend den für den jeweiligen Studiengang einschlägigen Tabellen in Abschnitt B - Besonderer Teil vergeben. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei einer durchschnittlichen Arbeitsbelastung von 30 Arbeitsstunden. Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 ECTS-Punkte.
#§ 14
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(
1
)
Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn ein Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt wird Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
(
2
)
Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen ein Attest einer von der Hochschule benannten Ärztin bzw. eines von der Hochschule benannten Arztes verlangt werden. Wird der Grund als triftig anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.
(
3
)
Soweit die Einhaltung von Fristen für
- die erstmalige Meldung zu Prüfungen oder
- die Wiederholung von Prüfungen,
oder soweit der Grund für das Versäumnis von Prüfungen sowie für Prüfungsleistungen betroffen ist, steht der Krankheit der Studierenden die Krankheit eines Kindes gleich, für das ihnen die Personensorge zusteht. Entsprechendes gilt bei einer Erkrankung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer oder eines nahen Angehörigen.
(
4
)
Versucht jemand, das Ergebnis der Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird diese Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.
(
5
)
Wer den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von der jeweils prüfenden oder der Aufsicht führenden Person von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) die zu prüfende Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.
(
6
)
Die von einer Entscheidung nach Absatz 4 bzw. nach Absatz 5 betroffene Person kann innerhalb einer Frist eines Monats verlangen, dass die Entscheidung vom Gemeinsamen Prüfungsausschuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen des Gemeinsamen Prüfungsausschusses sind ihr unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
#§ 15
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen
(
1
)
Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. In den im Abschnitt B - Besonderer Teil bestimmten Fällen ist eine Modulprüfung mit mehreren Prüfungsleistungen nur bestanden, wenn bestimmte Prüfungsleistungen mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.
(
2
)
Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn das Praktische Studiensemester (§ 36 bzw. § 44) bzw. alle Praktika (§ 52) erfolgreich abgeschlossen, sämtliche Modulprüfungen des Studiums bestanden und die Bachelorthesis mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden sowie die ECTS-Punkte gemäß § 13 Abs. 2 erreicht sind.
(
3
)
Wurde eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Bachelorthesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, so wird das der geprüften Person bekannt gegeben. Sie muss auch Auskunft darüber erhalten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung und die Bachelorthesis wiederholt werden können.(4) Wurde die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist.
#§ 16
Wiederholung von Modulprüfungen
(
1
)
Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Fachhochschulen bzw. Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland werden angerechnet.
(
2
)
In den Fällen von § 15 Abs. 1 Satz 2 ist nur eine einzelne, nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistung zu wiederholen.
(
3
)
Die Wiederholungsprüfung soll spätestens im Rahmen der Prüfungstermine des jeweils folgenden Theoriesemesters abgelegt werden. Wird die Frist für die Durchführung der Wiederholungsprüfung versäumt oder eine Modulprüfung erneut nicht bestanden, erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten.
(
4
)
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) kann abweichend von der Regelung des Absatzes 1 die zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung zulassen, wenn die bisherigen Studienleistungen insgesamt die Erwartung begründen, dass das Studium erfolgreich abgeschlossen werden kann und nachgewiesen ist, dass infolge einer außergewöhnlichen Belastung ein besonderer Härtefall vorliegt. Absatz 3 gilt entsprechend.
(
5
)
Der Gemeinsame Prüfungsausschuss kann auf der Basis der Evaluation (§ 5 Abs. 4) der Studien- und Prüfungsordnung beschließen, dass bestimmte Leistungsnachweise abweichend von der Regelung des Absatzes 1 wiederholt werden können.
#§ 17
Einsicht in die Prüfungsakten
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der geprüften Person auf Antrag in angemessener Form Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle (Prüfungsakten) gewährt.
#§ 18
Anerkennung und Anrechnung von Leistungen
(
1
)
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse werden anerkannt, wenn sie an einer anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu denjenigen Leistungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Eine Anerkennung unter Auflagen ist möglich.
(
2
)
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung unter Einbeziehung von bereits erreichten ECTS-Punkten vorzunehmen.
(
3
)
Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Universitäten, anderen Hochschulen und in staatlich anerkannten Fernstudien-Einrichtungen und an Dualen Hochschulen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an Fach- und Ingenieurschulen der ehemaligen DDR entsprechend.
(
4
)
Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden auf Antrag bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte angerechnet, soweit die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Die Kriterien für die Anrechnung gibt eine Anrech-nungsordnung vor.
(
5
)
Abgeschlossene Ausbildungen an Fachschulen und vergleichbare berufliche Ausbildungen können ebenso wie einschlägige Weiterbildungen, soweit ihre Gleichwertigkeit zu Prüfungsleistungen gegeben ist, auf Antrag angerechnet werden. Im Besonderen Teil werden zertifizierte Formen sowie auf andere Weise regelhaft erfolgende Anrechnungen von einschlägigen Fachausbildungen und Weiterbildungen geregelt. Unberührt bleibt eine Anrechnung im Einzelfall.
(
6
)
Werden hochschulische bzw. außerhochschulische Leistungen anerkannt bzw. angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung bzw. Anrechnung im Zeugnis (§ 30) ist zulässig.
(
7
)
Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 besteht ein Anspruch auf Anerkennung bzw. Anrechnung. Die Anerkennung bzw. Anrechnung von Leistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt seitens der Hochschule von Amts wegen. Die für die Anerkennung bzw. Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden vorzulegen. Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt.
(
8
)
Die Entscheidung über die Anerkennungen und Anrechnungen trifft im Einzelfall der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) im Anschluss an die Zulassung zum Studium.
#§ 19
Schutzbestimmungen bei Mutterschutz, Elternzeit und besonderen Lebenslagen
(
1
)
Auf Antrag einer Studierenden an den Gemeinsamen Prüfungsausschuss (§ 5) sind die Mutterschutzfristen, wie sie im Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Studien- und Prüfungsordnung.
(
2
)
Gleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) auf Antrag zu berücksichtigen. Die bzw. der Studierende muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie bzw. er die Elternzeit antreten will, dem Gemeinsamen Prüfungsausschuss unter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie bzw. er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Der Gemeinsame Prüfungsausschuss hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BEEG auslösen würden, und teilt der bzw. dem Studierenden das Ergebnis sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist der Bachelorthesis, einer Hausarbeit bzw. sonstiger schriftlicher Arbeit kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. Das gestellte Thema gilt als nicht vergeben. Nach Ablauf der Elternzeit wird der bzw. dem Studierenden ein neues Thema zur Bearbeitung gestellt.
(
3
)
Studierende können auf schriftlichen Antrag bei Nachweis einer besonders schwierigen Lebenslage, insbesondere wenn sie mit einem Kind unter 14 Jahren, für das ihnen die Personensorge zusteht, in demselben Haushalt leben und es überwiegend allein versorgen, einzelne Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in der Studien- und Prüfungsordnung hierfür vorgesehenen Fristen ablegen. Entsprechendes gilt für die Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen für Wiederholungsprüfungen können nur um bis zu zwei Semester verlängert werden. Die Antragsberechtigung erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem die in Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen; die Frist für das Erlöschen des Prüfungsanspruchs gemäß § 21 Abs. 3 und 4 beginnt mit dem Erlöschen der Berechtigung. Im Übrigen erlischt die Berechtigung spätestens mit Ablauf des Semesters, in dem das Kind sein vierzehntes Lebensjahr vollendet hat. Studierende haben die entsprechenden Nachweise zu führen und sind verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich der Hochschule mitzuteilen.
(
4
)
Macht eine zu prüfende Person glaubhaft, dass es ihr wegen Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht möglich ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder der vorgesehenen Frist abzulegen, so wird vom Prüfungsamt (§ 4) gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit zu erbringen. Nach Anhörung der oder des Beauftragten für Menschen mit Behinderungen/chronische Erkrankungen kann gestattet werden, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Beabsichtigt das Prüfungsamt einen Antrag auf Fristverlängerung abzulehnen, ist der studierenden Person die Möglichkeit zu geben, den oder die Beauftragte beizuziehen.
Es kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt für Studienleistungen (§§ 18, 20 Abs. 2).
#V. Prüfungen
#§ 20
Prüfungsaufbau
(
1
)
Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Die Modulprüfungen setzen sich aus einer oder mehreren Prüfungsleistungen oder einem lehrveranstaltungsübergreifenden Prüfungsgebiet zusammen. Im Abschnitt B – Besonderer Teil werden die Modulprüfungen der Bachelorprüfung sowie die einzelnen Prüfungsleistungen festgelegt. Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend in Verbindung und in inhaltlichem Bezug zu Modulen (studienbegleitende Prüfungsleistungen) abgenommen. Im Abschnitt B – Besonderer Teil sind für den Fall Regelungen enthalten dass nicht alle Modulprüfungen in die Gesamtwertung der Bachelorprüfung eingehen.
(
2
)
Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden die den einzelnen Modulen der Studiensemester zugeordneten Studien- oder Prüfungsleistungen festgelegt, die für die Zulassung zur Bachelorprüfung zu erbringen sind. Dabei kann vorgesehen werden, dass bestimmte Prüfungsleistungen spätestens bis zur Anmeldung zur letzten Prüfungsleistung einer Modulprüfung, zur Anmeldung der Bachelorthesis oder spätestens bis zur Aushändigung des Prüfungszeugnisses erbracht werden können.
#§ 21
Verlust der Zulassung zum Studiengang und des Prüfungsanspruchs, Fristen
(
1
)
Die Prüfungsleistungen zur Bachelorprüfung sollen im Rahmen eines Vollzeitstudiums bis zum Abschluss des siebten Semesters und im Rahmen eines Teilzeitstudiums bis zum Abschluss des vierzehnten Semesters abgelegt sein. Bei aufgrund von individuellen Härten durch das Prüfungsamt (§ 4) genehmigten individuellen Studienverlaufsplänen verlängert sich die Regelstudienzeit entsprechend.
(
2
)
Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studienleistungen und der zu absolvierenden Modulprüfungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Zeitpunkt der Ausgabe des Themas und der Abgabe der Bachelorthesis informiert. Den Studierenden werden für jede Modulprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt gegeben.
(
3
)
Der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den Studiengang erlöschen, wenn die Prüfungsleistungen für die Bachelorprüfung nicht spätestens vier Semester nach dem in Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt erbracht sind, es sei denn, die Fristüberschreitung ist nicht von der oder dem Studierenden zu vertreten. Das Gleiche gilt, wenn die Fristüberschreitung für die Bachelorprüfung insgesamt mehr als drei Semester beträgt (§ 32 Abs. 5 Satz 4 LHG).
(
4
)
Der Anspruch auf Zulassung zu Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung, soweit sie nicht studienbegleitend sind, bleibt bis zu zwei Jahre nach dem Erlöschen der Zulassung für den Studiengang bestehen, wenn die übrigen in der Studien- und Prüfungsordnung geforderten Prüfungsvorleistungen und studienbegleitenden Prüfungsleistungen im Zeitpunkt des Erlöschens der Zulassung erfüllt sind.
#§22
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
(
1
)
Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer
- aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechtigung für den Bachelorstudiengang an der Hochschule eingeschrieben ist,
- die Studienleistungen und die jeweiligen Modulprüfungen erfolgreich erbracht hat und
- eine Erklärung darüber vorlegt, ob in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG bestimmten Studiengang an einer Fachhochschule bzw. Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits eine Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden wurde.
(
2
)
Die oder der Studierende muss mindestens für das Semester vor der jeweiligen Modulprüfung an der Hochschule eingeschrieben gewesen sein und mindestens zwei Semester eingeschrieben sein, um die Bachelorthesis anmelden zu können.
(
3
)
Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn
- die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht erfüllt sind,
- die Unterlagen unvollständig sind,
- in demselben oder in einem nach § 60 Abs. 2 Nr. 2 LHG bestimmten Studiengang eine nach der Studien- und Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungsleistung oder Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden wurde oder sich die Person in einem Prüfungsverfahren befindet oder
- der Prüfungsanspruch nach § 32 Abs. 5 Satz 4 LHG erloschen ist.
§ 23
Fachliche Voraussetzungen
In Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zu den Modulprüfungen und zur Bachelorprüfung zu erbringen sind.
#VI. Bachelorprüfung
#§ 24
Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung
(
1
)
Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Bachelorstudiengangs. Durch die Bachelorprüfung wird festgestellt, ob
- die Zusammenhänge des Faches überblickt werden,
- die Fähigkeit vorhanden ist, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und
- die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben wurden.
(
2
)
Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden studienbegleitend (§ 8 Abs. 1) im Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen des Studiums durchgeführt.
#§ 25
Fachliche Voraussetzungen
(
1
)
Im Abschnitt B - Besonderer Teil werden nach Art und Zahl die Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen bestimmt, die als Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorprüfung zu erbringen sind.
(
2
)
Die erfolgreiche Teilnahme am Praktischen Studiensemester (§ 36 bzw. § 44) und gegebenenfalls den Praktika (§ 52) ist spätestens bei Ausgabe der Bachelorthesis nachzuweisen. In Fällen des § 44 Abs. 2 Satz 2 (Abweichungen von der Vollarbeitszeit) genügt das erfolgreiche Absolvieren des für das Praxissemester vorgesehenen Teils des Praktikums.
#§ 26
Art und Umfang der Bachelorprüfung
(
1
)
Im Abschnitt B - Besonderer Teil wird für die Bachelorprüfung festgelegt, welche Modulprüfungen abzulegen sind.
(
2
)
Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der Prüfungsfächer nach Maßgabe der im Abschnitt B - Besonderer Teil zugeordneten Lehrveranstaltungen.
#§ 27
Ausgabe, Bearbeitungszeit und Rückgabe der Bachelorthesis
(
1
)
Die Bachelorthesis ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll zeigen, dass die bzw. der Studierende innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten kann. Auf Antrag kann der Gemeinsame Prüfungsausschuss (§ 5) in begründeten Fällen einer späteren Ausgabe des Themas der Bachelorthesis zustimmen.
(
2
)
Die Bachelorthesis wird von einer Professorin bzw. einem Professor oder, soweit Professorinnen bzw. Professoren nicht als Prüfende zur Verfügung stehen, von Lehrbeauftragten bzw. Lehrkräften für besondere Aufgaben ausgegeben und betreut, soweit diese an der Hochschule in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich tätig sind.
(
3
)
Die Bachelorthesis kann in begründeten Ausnahmefällen auch von in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen, die selbst mindestens die durch die Bachelorthesis im jeweiligen Studiengang festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen, ausgegeben und betreut werden. Soll die Bachelorthesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung der Leitung des Prüfungsamtes (§ 4 Abs. 3).
(
4
)
Die Ausgabe der Bachelorthesis kann auf Antrag der bzw. des Studierenden auch über das Prüfungsamt erfolgen. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Auf Antrag wird vom Gemeinsamen Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe der Bachelorthesis veranlasst.
(
5
)
Die Bachelorthesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.
(
6
)
Die Bearbeitungszeit der Bachelorthesis beträgt 4 Monate innerhalb der Regelstudienzeit und außerhalb der Regelstudienzeit 3 Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorthesis sind von der Betreuerin bzw. vom Betreuer entsprechend der jeweils in Abschnitt B – Besonderer Teil vorgesehenen ECTS-Punkte so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit eingehalten werden kann. Soweit dies zur Gewährleistung gleicher Prüfungsbedingungen oder aus Gründen, die von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die Bearbeitungszeit um höchstens zwei Monate verlängert werden; die Entscheidung darüber trifft die Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes (§ 6).
(
7
)
Das Thema der Thesis kann nur einmal und nur innerhalb der ersten Hälfte der regelhaften Bearbeitungszeit zurückgegeben werden, ohne dass dies als Erstversuch gewertet wird.
#§ 28
Abgabe und Bewertung der Bachelorthesis
(
1
)
Die Bachelorthesis ist fristgemäß elektronisch einzureichen (durchsuchbare PDF-Datei) und auf Verlangen taggenau in Papierform zweifach beim Prüfungsamt (§ 4) abzugeben.
Rechtsverbindlicher Abgabezeitpunkt ist die elektronische Einreichung.
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe ist von der Verfasserin bzw. dem Verfasser der Bachelorthesis schriftlich zu versichern, dass die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit (§ 27 Abs. 5) der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden.
(
2
)
Die Bachelorthesis ist von zwei Prüfenden zu bewerten. Eine bzw. einer der Prüfenden soll die bzw. der Betreuende der Bachelorthesis sein. Eine bzw. einer der Prüfenden muss Professorin bzw. Professor oder eine andere lehrende Person mit professoralen Aufgaben sein.
(
3
)
Das Bewertungsverfahren soll die Dauer von vier Wochen nicht überschreiten.
(
4
)
Die Bachelorthesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ausfällt, einmal wiederholt werden. Die Ausgabe eines neuen Themas im Rahmen einer ersten Wiederholung ist innerhalb von zwei Monaten oder, zu dem darauf folgenden nächstmöglichen regulären Anmeldetermin nach der Bekanntgabe des Nichtbestehens schriftlich bei der Leiterin bzw. dem Leiter des Prüfungsamtes zu beantragen. Wird die Antragsfrist versäumt, erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten. Der Prüfungsanspruch erlischt ebenfalls, wenn die Bachelorthesis erneut mit schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet wird.
#§ 29
Zusatzmodule
Studierende können sich einer Modulprüfung (§ 20) in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis der Modulprüfung in diesen Modulen wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.
#§ 30
Bildung der Gesamtnote, Prüfungszeugnis
(
1
)
Die Gesamtnote errechnet sich gemäß § 12 Abs. 2 bis 4 aus den Modulnoten und der Note der Bachelorthesis sowie gegebenenfalls aus der Note des Abschlusskolloquiums. In Abschnitt B – Besonderer Teil wird für einzelne Modulnoten, die Note der Bachelorthesis und gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums jeweils eine besondere Gewichtung vorgesehen.
(
2
)
Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote mindestens 1,3) wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt.
(
3
)
Über die bestandene Bachelorprüfung wird möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis sind die Modulnoten, das Thema der Bachelorthesis und deren Note, gegebenenfalls die Note des Abschlusskolloquiums sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Die Noten sind mit dem nach § 12 Abs. 4 ermittelten Dezimalwert als Zusatz in Klammern zu versehen.
#§ 31
Bachelorgrad und Bachelorurkunde
(
1
)
Die Hochschule verleiht nach bestandener Bachelorprüfung in den in § 1 genannten Studiengängen den Bachelorgrad „Bachelor of Arts“.
(
2
)
In einem Diploma Supplement (Diplomzusatz mit Studiengangserläuterung) werden jeweils die Studienrichtung sowie – auf Antrag – die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benötigte Studiendauer aufgenommen. Es enthält darüber hinaus detaillierte Information über das Studienprogramm (Zugangsvoraussetzungen, Studienanforderungen, Studienverlauf und optionale weitere Information). Im letzten Abschnitt enthält das Diploma Supplement einen Text, in dem das deutsche Studiensystem beschrieben wird. Es wird in der Standardform in deutscher und englischer Sprache ausgestellt.
(
3
)
Zusätzlich zu dem Zeugnis wird die Bachelorurkunde ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Rektorin bzw. der Rektor unterzeichnet die Bachelorurkunde und drückt ihr das Siegel der Hochschule bei.
#§ 32
Ungültigkeit der Bachelorprüfung
(
1
)
Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 14 Abs. 4 berichtigt werden. Liegt ein besonders schwerer Täuschungsversuch vor, können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelorthesis.
(
2
)
Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung (§ 20) nicht erfüllt, ohne dass die zu prüfende Person hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung geheilt. Wurde vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass die Modulprüfung abgelegt werden konnte, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Bachelorprüfung für nicht bestanden erklärt werden.
(
3
)
Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Studierenden Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(
4
)
Das unrichtige Zeugnis ist von der Hochschule einzuziehen. Gegebenenfalls ist ein neues Zeugnis zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.
#VII. Experimentierklausel
#§ 33
Experimentierklausel
(
1
)
Im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Hochschule (§ 7 Abs. 3 EH-G) können einzelne, in Abschnitt B - Besonderer Teil der Prüfungsordnung vorgesehene Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen probeweise durch andere ersetzt, in ihrer Lage verlegt oder mit anderen Prüfungsleistungen abgeprüft werden. Voraussetzung für die Erprobung in diesem Sinne ist ein entsprechender Beschluss der Fachbereichsräte, des Gemeinsamen Prüfungsausschusses (§ 5) und des Senates der Hochschule.
(
2
)
Die Erprobung von Veränderungen von Modulen, Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen ist systematisch auszuwerten. Im Kuratorium ist über die Erfahrungen durch die Rektorin bzw. den Rektor Bericht zu erstatten.
#B. Besonderer Teil
#- I. Bachelorstudiengang Religion und Sozialesmit den Studienschwerpunktena) Diakonie und Religionspädagogik oderb) Religion und Soziales in interkulturellen Kontexten
§ 34
Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester. Sie umfasst die theoretischen Studiensemester, ein integriertes Praktisches Studiensemester (§ 36) und die Prüfungen einschließlich der Abschlussarbeit (Bachelorthesis). Der Studiengang kann angepasst an individuelle Rahmenbedingungen in bis zu vierzehn Semestern studiert werden (§13 Abs. 1).
#§ 35
Studienaufbau und Stundenumfang
Das Studium umfasst in Vollzeit sieben Semester, bei besonderen Rahmenbedingungen in individuellen Studienverläufen bis zu 14 Semester.
(
2
)
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 ECTS-Punkte (§ 13 Abs. 3). Näheres regelt die Tabelle zu § 40.
#§ 36
Praktisches Studiensemester
Ein Praktisches Studiensemester, als von der Hochschule inhaltlich bestimmter und begleiteter Ausbildungsabschnitt, wird frühestens im 3. Fachsemester absolviert.
Die Studierenden absolvieren in einer Einrichtung der Berufspraxis, angeleitet von einer berufserfahrenen Fachkraft, mindestens 100 Präsenztage oder 800 Präsenzstunden, im Umfang der jeweils in der Praxisstelle üblichen Vollarbeitszeit. In persönlichen Härtefällen insbesondere aufgrund von Krankheiten oder familiären Betreuungsverpflichtungen kann eine Abweichung von der Vollarbeitszeit beim Praxisamt der EH beantragt werden. Die Zahl der Präsenztage erhöht sich dann entsprechend. Das Praktische Studiensemester kann aus diesen Gründen auch zu einem Umfang von bis zu 50% reduziert und in Teilzeitbeschäftigung absolviert werden. Dies hat die Splittung des Praktischen Studiensemesters zur Folge, was zu einer Verlängerung des Studiums führt. In krankheitsbedingten Einzelfällen kann die Anzahl der geforderten Präsenztage, durch Antragstellung auf 95 Tage herabgesetzt werden. Die Entscheidung trifft die Leitung des Praxisamts.
Mit Studierenden, die in individuellen Studienverläufen studieren (§ 34), werden gesonderte Vereinbarungen getroffen, die sowohl die Disponibilität der Studierenden (Vereinbarkeit) berücksichtigen als auch die Anforderungen der Praxisstelle und die dort von den Studierenden zu übernehmenden Aufgaben reflektieren.
Während des Praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von einer Professorin bzw. einem Professor (Begleitdozentin bzw. Begleitdozent) fachlich betreut. Die Hochschule arbeitet in allen die berufspraktische Ausbildung der Studierenden betreffenden Fragen mit den Praxisstellen zusammen.
Während des Praktischen Studiensemesters nehmen die Studierenden an Supervision im Umfang von einer SWS teil. Die Supervision findet in der Regel in Gruppen statt. Nähere Informationen sind dem Praxisleitfaden zu entnehmen.
Über den Kompetenzerwerb des Praktischen Studiensemesters erstellen die Studierenden einen schriftlichen Bericht. Die Praxisstelle erstellt am Ende des Praktischen Studiensemesters einen Tätigkeitsnachweis mit persönlicher Beurteilung, der Anfangs- und Enddatum des Praktikums, die Anzahl der abgeleisteten Präsenztage, Art und Inhalt der Tätigkeit sowie eine Beschreibung des Lernprozesses der Studierenden beinhaltet. Auf Grundlage des Praxisberichts und des Tätigkeitsnachweises entscheidet der oder die Begleitdozierende (Absatz 3) in Abstimmung mit dem Praxisamt über die erfolgreiche Ableistung des Praktischen Studiensemesters. Wird dies nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, so kann es einmal wiederholt werden. Zuständig für diese Entscheidung ist die Leitung des Praxisamts.
Die Studierenden suchen sich eigenständig eine geeignete Praxisstelle, das Praxisamt unterstützt hierbei beratend. Die Anerkennung der Praxisstellen obliegt der Leitung des Praxisamtes im Einvernehmen mit der Dekanin bzw. dem Dekan des zuständigen Fachbereichs.
Dem Praxisamt obliegt die organisatorische Abwicklung der Praktischen Studiensemester, die Koordination der Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den Praxisstellen. Näheres regelt der Leitfaden zum Praktischen Studiensemester.
#§ 37
Studienziel
(
1
)
Der Bachelorstudiengang Religion und Soziales ist ein grundständiger Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt.
(
2
)
Ziel des Studienganges ist es, die Studierenden durch praxisorientierte Lehre auf wissenschaftlicher Grundlage unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher und globaler Entwicklungen zu professionellem Handeln zu befähigen: a) im kirchlich-gemeindlichen Bereich der Diakonie und Religionspädagogik (D-RP) sowie der schulischen Religionspädagogik bzw. b) in sozial-diakonischen Arbeitsfeldern (RSInt), in denen wertebasiert-religiöse Prozesse sowie interkulturelle und internationale Perspektiven eine besondere Rolle spielen.
Der generalistisch ausgerichtete Studiengang zielt auf die Qualifikation für unterschiedliche berufliche Tätigkeitsfelder und Arbeitsanforderungen in gemeindepädagogischen, religionspädagogischen und sozial-diakonischen Arbeitsfeldern. Die Studierenden erwerben theologische und fachspezifische Kompetenzen. Das beinhaltet, fachliche Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen aufeinander zu beziehen und fachliche Methoden und Erkenntnisse selbständig und zielgruppenorientiert in verschiedenen Arbeitsfeldern von Kirche und Diakonie bzw. Sozialer Arbeit wissenschaftlich reflektiert anzuwenden.
Der Studiengang vermittelt Studierenden die Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse, Arbeitsformen, Fragestellungen und Methoden sowie das Kennenlernen der professionellen Praxis inklusive der Reflexion eigener Praxiserfahrungen. Er fördert die religiöse Sprachfähigkeit, die interkulturelle Kompetenz sowie die theologische und ethische Reflexion.
Die Interaktion mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie die religions- und sozialpädagogische Begleitung von Menschen in allen Lebensaltern erfordern neben wissenschaftlichem Wissen und handlungspraktischen Kompetenzen auch die Fähigkeit, Diversität in Lebensentwürfen und Lebenslagen wahrzunehmen, eigene Haltungen und Handlungen zu reflektieren sowie die Entwicklung einer professionellen Haltung, die eine Positionierung in interreligiösen und interkulturellen Kontexten ermöglicht.
Die Studierenden werden dazu befähigt, den Zusammenhang von wissenschaftlichem Wissen und professioneller Praxis herzustellen und in den Handlungsfeldern von Gemeindepädagogik, Religionspädagogik und Diakonie bzw. Sozialer Arbeit reflexiv und diversitätssensibel professionell zu handeln.
(
3
)
Es sollen berufsqualifizierende Fähigkeiten in folgenden fünf Studienbereichen erworben werden:
- Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen: Grundkompetenzen und Identität als professionelle Fachkräfte in Handlungsfeldern von Kirche, Diakonie und Gesellschaft entwickeln.
- Religion verstehen und analysieren: Christlich orientierte und zugleich dialogische Perspektiven auf Religion vertiefen und auf kirchliche oder soziale Praxisfelder unter Berücksichtigung interkultureller und interreligiöser Dimensionen beziehen sowie im Rahmen gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Herausforderungen eigene Positionen bilden und kommunizieren.
- Alltagsbezug und Lebensweltorientierung: Religiöse, psychosoziale und soziostrukturelle Perspektiven bezogen auf die Lebenssituationen von Menschen erarbeiten und verschränken.
- Schlüsselqualifikationen und Bezugswissenschaften: Soziale und selbstreflexive Kompetenzen entwickeln und multi- und interdisziplinär einüben, insbesondere die Fähigkeiten, Verschiedenheit (Diversity) differenziert wahrzunehmen und kultursensibel mit ihr umgehen können – inklusiv entsprechender ästhetischer, kultureller und religiöser Ausdrucksformen.
- Professionelles Handeln in Feldern der Religion, Bildung und Soziales: Anhand von ausgewählten Handlungsfeldern von Gemeinde, Schule und internationaler Kooperation exemplarisch vertieft den gesamten Prozess professionellen Handelns nachvollziehen, reflektieren und gestalten.
§ 38
Bestandteile des Studienganges
(
1
)
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 210 Creditpoints, die in 105,3 Semesterwochenstunden (SWS) erbracht werden.
(
2
)
Die Lehrveranstaltungen sollen in der Reihenfolge gemäß § 40 studiert werden. Verbindliche Abfolgen von Lehrveranstaltungen sind im Modulhandbuch ausgewiesen. Aus Gründen einer Flexibilisierung des Studiums (Teilzeit, Berufsintegrierendes Studium, Internationales Profil) kann die Reihenfolge variiert werden. Prüfungsleistungen, Prüfungsvorleistungen und Studienleistungen werden in dem Semester absolviert, in dem das zugehörige Modul studiert wird.
(
3
)
Das Studium ist in fünf modularisierte Studienbereiche gegliedert:
1. Pädagogik in Gemeinde und Gemeinwesen
1.1 Gemeindepädagogik als Wissenschaft und Praxis I
1.2 Gemeindepädagogik als Wissenschaft und Praxis II
1.3 Gemeindepädagogik als Profession und Professionalität
2. Religion verstehen und analysieren
2.1 Bibelwissenschaft I
2.2 Bibelwissenschaft II
2.3 Bibelwissenschaft III
2.4 Systematische Theologie I und Kirchengeschichte
2.5 Systematische Theologie II
2.6 Kirche und Ökumene
3. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung
3.1 Lebensphasen und humanwissenschaftliche Grundlagen
3.2 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt I (psychosoziale Perspektive): Bewältigungsaufgaben und -formen
3.3 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt II (soziostrukturelle Perspektive): Familie und Sozialraum
4. Schlüsselqualifikationen und Bezugswissenschaften
4.1 Methoden sozialer Arbeit
4.2 Umgang mit Vielfalt in Religion und Kultur I
4.3 Umgang mit Vielfalt in Religion und Kultur II
4.4 Gestaltung von Gesellschaft: Soziologie, Ökonomie und Politik
4.5 Kommunikation und Gestaltung in religiösen Zusammenhängen
5. Professionelles Handeln in Feldern der Religion, Bildung und Soziales
5.1 Praktisches Studiensemester
5.2 Einführung in Seelsorge und Erwachsenenbildung
5.3 Handlungsfelder Seelsorge und Erwachsenenbildung
5.4 Handlungsfeld nonformale Bildung: Kinder und Jugendliche
5.5 Bachelorthesis – Vorbereitung, Begleitung, Durchführung
5.6 D-RP Handlungsfeld Religionsunterricht Grundschule
5.7 D-RP Handlungsfeld Religionsunterricht Sekundarstufe I
5.8 D-RP Diakonie, Bibel und Bildung
5.6 RSint: Religion und soziokulturelle Transformation
5.7 RSint: Religion und interkulturelle Lernprozesse
(
4
)
Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie setzen sich aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen zusammen. Lehrveranstaltungszeiten können ganz oder teilweise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusammengefasst werden, insbesondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifikationen dient. Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich aus Präsenzzeiten, Zeiten des Selbststudiums und der Prüfungsvorbereitung zusammen.
(
5
)
Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; jedem Modul sind eine bestimmte Anzahl von Creditpoints (CP) zugeordnet.
(
6
)
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module, die zugehörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus der Tabelle zu § 40.
Dabei werden für Lehrveranstaltungen (abgekürzt: LV) folgende Abkürzungen verwendet:
Pro | = | praxisbezogenes Projekt |
pS | = | Praktisches Studiensemester |
S | = | Seminar |
Sch | = | Schulpraktikum |
T | = | Tutorat/Coaching |
Ü | = | Übung |
ZI | = | Vorlesung oder Lektüre. |
(
7
)
Die Art, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt. Folgende Abkürzungen werden im Folgenden verwendet:
H | = | Hausarbeit |
K | = | Klausur |
L | = | Lehrprobe |
M | = | Mündliche Prüfung |
R | = | Referat |
Koll | = | Kolloquium |
kV | = | Kurstypisches Verfahren |
Für Prüfungsvorleistungen (PVL) werden folgende Abkürzungen verwendet:
H | = | Hausarbeit |
K | = | Klausur |
M | = | Mündliche Prüfung |
R | = | Referat |
kV | = | Kurstypisches Verfahren |
§ 39
Berufsintegrierendes Studium
Es besteht die Möglichkeit, den Studienschwerpunkt a) Diakonie und Religionspädagogik berufsintegrierend zu studieren. Voraussetzung ist eine Arbeitsstelle im gemeindlich-diakonischen Bereich im Umfang von mindestens 30%.
(1) Zur Vereinbarkeit von Studium und Beruf schließt die EH mit der Arbeitsstelle eine Kooperationsvereinbarung ab.
(2) Anwendungsorientierte Module bzw. Lehrveranstaltungen können in Kooperation mit der Arbeitsstelle durchgeführt werden. Die Überprüfung der zu erreichenden Kompetenzen obliegt den Fachdozierenden der EH.
(3) Unbeschadet der Geltung der SPO werden ausgewählte Lehrveranstaltungen mit Selbststudium und/oder als Blended-Learning organisiert.
#§ 40
Studienaufbau und Prüfungen
(
1
)
Voraussetzung für die Anmeldung der Bachelorthesis ist es, dass das Praxissemester sowie im Studienschwerpunkt „Diakonie und Religionspädagogik“ beide Schulpraktika erfolgreich absolviert sind.
(
2
)
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen Module und Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich (WPO sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus folgender Tabelle:
§ 41
Berechnung der Noten der Module, der Bachelorvorprüfung und der Bachelorprüfung
(
1
)
Sofern in einem Modul mehrere benotete Leistungsnachweise zu erbringen sind und sofern keine abweichende Regelung vorgesehen ist, wird die Note für das Modul als arithmetisches Mittel der Einzelnoten errechnet.
(
2
)
Die Noten des ersten und zweiten Fachsemesters zählen nicht für die Bachelorabschlussnote.
(
3
)
Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich wie folgt:
II. Bachelorstudiengang Soziale Arbeit
Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester, im Teilzeitstudiengang vierzehn Semester. Sie umfasst die theoretischen Studiensemester, ein integriertes Praktisches Studiensemester (§ 44) und die Prüfungen einschließlich der Abschlussarbeit (Bachelorthesis).
#§ 42
Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudiengang sieben Semester, im Teilzeitstudiengang vierzehn Semester. Sie umfasst die theoretischen Studiensemester, ein integriertes Praktisches Studiensemester (§ 44) und die Prüfungen einschließ-lich der Abschlussarbeit (Bachelorthesis).
#§ 43
Studienaufbau und Studienumfang
(
1
)
Das Studium gliedert sich in sieben Semester (Teilzeit: vierzehn Semester). Es enthält ein praktisches Studiensemester und schließt mit der Bachelorprüfung ab.
(
2
)
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 ECTS-Punkte (§ 13 Abs. 2). Näheres regelt die Tabelle zu § 48.
#§ 44
Praktisches Studiensemester
(
1
)
Das Praktische Studiensemester ist ein ins Studium integrierter (§ 43 Abs. 1), von der Hochschule inhaltlich bestimmter und betreuter Ausbildungsabschnitt.
(
2
)
Die Studierenden absolvieren in einer Einrichtung der Berufspraxis, angeleitet von einer berufserfahrenen Fachkraft der Sozialen Arbeit, mindestens 100 Präsenztage oder 800 Präsenzstunden, im Umfang der jeweils in der Praxisstelle üblichen Vollarbeitszeit. In persönlichen Härtefällen insbesondere aufgrund von Krankheiten oder familiären Betreuungsverpflichtungen kann eine Abweichung von der Vollarbeitszeit beim Praxisamt beantragt werden. Die Zahl der Präsenztage erhöht sich dann entsprechend.
Das Praktische Studiensemester kann aus diesen Gründen auch zu einem Umfang von bis zu 50% reduziert und in Teilzeitbeschäftigung absolviert werden. Dies hat die Splittung der Praktischen Studiensemesters zur Folge, was zu einer Verlängerung des Studiums führt.
In krankheitsbedingten Einzelfällen kann die Anzahl der geforderten Präsenztage, durch Antragstellung, auf 95 Tage herabgesetzt werden. Die Entscheidung trifft die Leitung des Praxisamts.
(
3
)
Während des Praktischen Studiensemesters werden Studierende in der Regel von einer Professorin oder einem Professor betreut. Die Hochschule arbeitet in allen die berufspraktische Ausbildung der Studierenden betreffenden Fragen mit den Praxisstellen zusammen. Während des Praktischen Studiensemesters nehmen die Studierenden an Supervision teil, im Umfang von einer Semesterwochenstunde. Die Supervision findet in der Regel in Gruppen statt. Nähere Informationen sind dem Praxisleitfaden zu entnehmen.
(
4
)
Die Studierenden erstellen über den Kompetenzerwerb während des Praktischen Studiensemesters einen schriftlichen Bericht und lassen diesen von der Praxisstelle bestätigen. Die Praxisstelle erstellt einen Tätigkeitsnachweis mit persönlicher Beurteilung, der Anfangs- und Enddatum des Praktikums, die Anzahl der abgeleisteten Präsenztage und Art und Inhalt der Tätigkeit ausweist sowie den Lernprozesses beschreibt. Auf Grundlage des Praxisberichts und des Tätigkeitsnachweises entscheidet der/die Begleitdozierende in Abstimmung mit dem Praxisamt, über die erfolgreiche Ableistung des Praktischen Studiensemesters. Wird dies nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, kann es einmal wiederholt werden. Zuständig für diese Entscheidung ist die Leitung des Praxisamts.
(
5
)
Die Studierenden suchen sich selbst einen Praktikumsplatz. Dabei werden sie vom Praxisamt unterstützt. Die Anerkennung der Praxisstellen obliegt der Leitung des Praxisamts im Einvernehmen mit der Dekanin oder dem Dekan.
(
6
)
Das Praktische Studiensemester kann nur begonnen werden, wenn bis zur Anmeldung der Praxisstelle beim Praxisamt aus den vorangegangenen Studiensemestern mindestens 15 ECTS-Punkte erreicht wurden.
(
7
)
Die Hochschule unterhält ein Praxisamt. Diesem obliegt die organisatorische Abwicklung der Praktischen Studiensemester, die Beratung der Studierenden, die Koordination der Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den Praxisstellen.
#§ 45
Studienziel
(
1
)
Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ist ein grundständiger Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt.
(
2
)
Studienzielen und Studienaufbau des Studiengangs liegt die „Definition of Social Work“ der International Federation of Social Workers (IFSW) aus dem Jahr 2014 zugrunde, zitiert in der deutschen Übersetzung des Fachbereichstags Soziale Arbeit (FBTS) und des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH) vom Juni 2016:
„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein.“
(
3
)
Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden durch praxisorientierte Lehre auf wissenschaftlicher Grundlage für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit zu befähigen.
Dabei umfasst Soziale Arbeit nicht nur personenbezogene, mikroökologische Dimensionen, sondern berücksichtigt auch rechtliche, ökonomische und soziostrukturelle Rahmenbedingungen sowie sozial- und gesellschaftspolitische (makroökologische) Perspektiven.
Das Studium vermittelt inter- und transdisziplinäre sowie interprofessionelle Kompetenzen, die zur Analyse sozialer Probleme wie Armut, Diskriminierung, Sucht, Exklusion und Delinquenz als auch zur Auseinandersetzung mit menschlichen Entwicklungspotenzialen durch Erziehung, Bildung und sozialstaatliche Interventionen befähigen. Die Interaktion mit Menschen in unterschiedlichen Notlagen sowie die sozialpädagogische Begleitung von Menschen in allen Lebensaltern erfordern neben wissenschaftlichem Wissen und handlungspraktischen Kompetenzen auch die Fähigkeit, Diversität in Lebensentwürfen und Lebenslagen wahrzunehmen, eigene Haltungen und Handlungen zu reflektieren sowie die Entwicklung einer professionellen Haltung, die eine Positionierung im sozialpolitischen Kontext ermöglicht.
Der Studiengang vermittelt Studierenden, die Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse, Arbeitsformen, Fragestellungen und Methoden sowie das Kennenlernen der professionellen Praxis inklusive der Reflexion eigener Praxiserfahrungen. Er fördert die ethische Reflexion und religiöse Sprachfähigkeit. Die Studierenden werden dazu befähigt, den Zusammenhang von wissenschaftlichem Wissen und professioneller Praxis herzustellen und in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit reflexiv und gesellschaftskritisch Problemlösungen zu entwickeln.
Der generalistisch ausgerichtete Studiengang zielt auf die Qualifikation für unterschiedliche berufliche Tätigkeitsfelder und Arbeitsanforderungen im breiten Berufsfeld der Sozialen Arbeit. Das beinhaltet, fachlichen Zusammenhänge zu überblicken und fachübergreifend Probleme zu lösen sowie fachliche Methoden und Erkenntnisse selbständig anzuwenden. Dabei wird durch die Kombination von wissenschaftlichen Grundlagen und Kompetenzen zur Praxisforschung sowie exemplarisch ausgewählten handlungsfeldbezogenen Vertiefungen gewährleistet, dass die Absolventinnen und Absolventen in allen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig werden können.
(
4
)
Die Ziele des Studiengangs werden durch den Erwerb von berufsqualifizierenden Kompetenzen in vier Studienbereichen erreicht:
- Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit: Eine Identität als professionelle Fachkräfte in der Sozialen Arbeit entwickeln,
- Alltagsbezug und Lebensweltorientierung: Psychosoziale und sozialstrukturelle Perspektiven einnehmen und verschränken können,
- Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit: die rechtlichen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen kennen und bewerten, unter denen Soziale Arbeit stattfindet.
- Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit: Anhand von konkreten Handlungsfeldern exemplarisch vertieft den gesamten Prozess professionellen Handelns nachvollziehen, reflektieren und gestalten können.
§ 46
Bestandteile des Studienganges
(
1
)
Der Gesamtumfang, der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt 210 ECTS-Punkte, die in 116,3 Semesterwochenstunden (SWS) erbracht werden.
(
2
)
Der Studiengang kann als Vollzeitstudiengang oder als Teilzeitstudiengang belegt werden.
(
3
)
Das Studium ist in vier Studienbereiche (§ 45 Abs. 4) gegliedert, welchen folgende Module zugeordnet sind:
1. Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit
1.1 Einstieg in das Studium und wissenschaftliche Arbeiten (zweisemestrig)
1.2 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil I
1.3 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil II
1.4 Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit Teil III
1.5 Offenes Vertiefungsmodul
1.6 Professionelle Identität
2. Alltagsbezug und Lebensweltorientierung
2.1 Lebensphasen
2.2 Bezugswissenschaftliche Grundlagen: Psychologie und Pädagogik
2.3 Diversität und Diskriminierung – Anerkennung und Teilhabe
2.4 Diversity – Wissen und Handlungskompetenz
2.5 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt Teil I (psychosoziale Perspektive): Bewältigung und Lebensführung
2.6 Alltagsbewältigung in der Lebenswelt Teil II (sozialstrukturelle Perspektive): Familie und Sozialraum
3. Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit
3.1 Sozialrecht I (zweisemestrig)
3.2 Bezugswissenschaftliche Grundlagen: Soziologie, Politik und Ökonomie
3.3 Sozialrecht Teil II (zweisemestrig)
3.4 Gestaltung des Sozialen: Sozialpolitik, Sozialwirtschaft und Freie Wohlfahrtspflege
3.5 Ethik, Anthropologie, Religion
4. Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit
4.1 Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit (zweisemestrig)
4.2 Praktisches Studiensemester mit begleitender Konsultation und Supervision
4.3 Forschungsmethoden (zweisemestrig)
4.4 Handlungsfelder Sozialer Arbeit I
4.5 Studienprojekt (zweisemestrig)
4.6 Handlungsfelder Sozialer Arbeit II
4.7 Medien, Kunst, Bewegung und Musik als pädagogische Zugänge zu Menschen (zweisemestrig)
a. Bachelorthesis
(
4
)
Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie können sich aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen zusammensetzen. Lehrveranstaltungsstunden können auch ganz oder teilweise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusammengefasst werden, insbesondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifikationen dient. Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich aus Präsenzzeiten, Zeiten des Selbststudiums und Zeiten der Prüfungsvorbereitung zusammen.
(
5
)
Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; jedem Modul ist eine bestimmte Anzahl von Creditpoints (CP) zugeordnet.
(
6
)
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module und die zugehörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus der Tabelle zu § 48. Dabei werden für Lehrveranstaltungen (abgekürzt: LV) folgende Abkürzungen verwendet
Pro | = | praxisbezogenes Projekt |
pS | = | Praktisches Studiensemester |
S | = | Seminar |
T | = | Tutorat/Coaching |
Ü | = | Übung |
ZI | = | Zentraler Input: Vorlesung oder Lektüre |
(
7
)
Die Art, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt.
Folgende Abkürzungen werden verwendet:
H | = | Hausarbeit |
K | = | Klausur |
M | = | Mündliche Prüfung |
R | = | Referat |
kV | = | kurstypisches Verfahren |
Für Prüfungsvorleistungen (PVL) werden folgende Abkürzungen verwendet:
B | = | Bericht |
K | = | Klausur |
kV | = | kurstypisches Verfahren |
P | = | Protokoll, bzw. Praktische Übung |
R | = | Referat |
Bei Modulen, die sich über mehrere Semester erstrecken, können Prüfungsleistungen und Prüfungsvorleistungen aus mehreren Teilleistungen bestehen:
TL = Teilleistung
Bei Lehrveranstaltungen, für die weder Prüfungsleistung noch Prüfungsvorleistung vorgesehen sind (§ 8):
SL = Studienleistung
#§ 47
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen bzw. Prüfungsvorleistungen sind in der Tabelle zu § 48 durch einen Schrägstrich gekennzeichnet.
#§ 48
Studienaufbau und Prüfungen
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiengangs erforderlichen Module und Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich (WP) sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus folgender Tabelle:
§ 49
Berechnung der Noten der Module und der Bachelorprüfung
(
1
)
Sofern in einem Modul mehrere benotete Leistungsnachweise zu erbringen sind und sofern keine abweichende Regelung vorgesehen ist, wird die Note für das Modul als arithmetisches Mittel der Einzelnoten errechnet.
(
2
)
In Studienbereich 4 wird im Hauptstudium das arithmetische Mittel aus den Modulen 4.1 bis 4.9 gebildet; die Bachelorabschlussarbeit (Bachelorthesis) geht gesondert in die Gesamtnote ein.
(
3
)
Die Gesamtnote für die Bachelorprüfung errechnet sich wie folgt:
Studienbereiche/Modulprüfung | Kennziffer der zugehörigen Module | Gewichtung für die Gesamtnote |
Studienbereich 1: Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit | 4-1.4 7-1.5 7-1.6 | 1/20 1/20 1/20 |
Studienbereich 2: Alltagsbezug und Lebensweltorientierung | 5-2.4 5-2.5 6-2.6 | 1/20 1/20 1/20 |
Studienbereich 3: Gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit | 4/5-3.3 4-3.4 5-3.5 | 1/20 1/20 1/20 |
Studienbereich 4: Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit | 4/5-4.3 4-4.4 5/6-4.5 6-4.6 | 1/20 2/20 2/20 2/20 |
Abschlussarbeit: Bachelorthesis | 7-4.10 | 4/20 |
Studien- und Prüfungsordnung
#B. Besonderer Teil
#III. Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik
#§ 50
Regelstudienzeit
Die Regelstudienzeit bis zum Erwerb des akademischen Grades beträgt einschließlich aller zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen im Vollzeitstudiengang sieben Semester. Im Teilzeitstudium beträgt die Regelstudienzeit 14 Semester.
#§ 51
Studienaufbau und Stundenumfang
(
1
)
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Leistungen beträgt 210 Credit-Points (§§ 13, 54).
(
2
)
Die Anzahl der pro Semester zu erwerbenden ECTS-Punkte beträgt bei einem Vollzeitstudium 27 bis 33 Punkte (Anlage 1 zu § 53 f.), bei einem Teilzeitstudium 12 bis 18 Punkte (Anlage 2 zu § 53 f.). Insgesamt können in beiden Varianten des Studiengangs (§ 50) einschließlich Abschluss jeweils 210 ECTS-Punkte erworben werden.
#§ 52
Praktika
(
1
)
Im Vollzeitstudium sind im zweiten, vierten und fünften Semester drei jeweils mehrwöchige und betreute Praktika vorgesehen (s. Anlage 3). Im Teilzeitstudium sind diese Praktika im vierten, sechsten, achten und elften Semester angesiedelt (ein größeres Praktikum wird geteilt).
(
2
)
Das jeweils zuletzt zu absolvierende Praktikum hat eine Dauer von drei Monaten und ist nach Möglichkeit im Ausland zu erbringen. Ersatzweise kann dies in einer Einrichtung in Deutschland erfolgen, wobei auch hier die Auseinandersetzung der Studierenden mit Praxisphänomenen von einer internationaler Perspektive geprägt sein muss.
(
3
)
Die mit den Praktika verbundenen Qualifikationsziele, der Umfang der Praktika, die Praktikumsbetreuung und die Modulprüfungsleistungen sind in den Beschreibungen zu den Modulen „Spiel und Kasuistik“, „Lernort Praxis“ sowie „Kindheitspädagogische Handlungsfelder – internationale Perspektive“ im Modulkatalog aufgeführt. Angaben zur Organisation und zur Auswahl bzw. Anerkennung von Praxisstellen sind in Handreichungen genannt, die vom Praxisamt ausgegeben werden.
(
4
)
Voraussetzung für das dritte Praktikum ist die erfolgreiche Teilnahme am zweiten Praktikum. Von dieser Regelung kann in begründeten Fällen abgewichen werden.
#§ 53
Studienziel
(
1
)
Der Studiengang (im Vollzeit- und im Teilzeitstudium) vermittelt grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in der fächerübergreifenden wissenschaftlichen und kindheitspädagogischen Beschäftigung mit Fragen der Betreuung, Erziehung und Bildung von jungen Kindern im Alter von null bis vierzehn Jahren. Kindheitspädagogische Professionalität bezieht sich dabei sowohl auf Aspekte des Wissens und Könnens im beruflichen Umfeld (fachliche und methodische Kompetenz) als auch auf Aspekte sozialer Kompetenz, Reflexivität und auf berufliche bzw. Werte-Orientierungen (Lernkompetenz und Selbstkompetenz).
(
2
)
Die Vermittlung und Erarbeitung der in Absatz 1 genannten Studienziele und Kompetenzen erfolgt beim Studiengang (Vollzeit- und Teilzeitvariante) innerhalb entsprechender Module (Anlage 1 und 2) und insbesondere durch curricular integrierte Praktika (Anlage 3).
#§ 54
Bestandteile des Studienganges
(
1
)
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen beträgt 210 Credit-Points, die in 119 Semesterwochenstunden (SWS) erbracht werden.
(
2
)
Das Studium gliedert sich jeweils in sechs Studienbereiche:
- Erziehungs- und bezugswissenschaftliches Wissen und Können,
- Gestaltung von Bildungssituationen,
- Umgang mit Unterschiedlichkeit und Kindern in besonderen Ausgangslagen,
- Handeln im Lernort Praxis,
- Professionswissen und –können,
- Vernetzung und Arbeiten mit dem Umfeld.
Diese Studienbereiche umfassen meist mehrere Module, deren Anordnung im Studienverlauf sich aus Anlage 1 (Vollzeitstudium) bzw. Anlage 2 (Teilzeitstudium) ergibt.
(
3
)
Den Modulen sind Lehrveranstaltungen zugeordnet; sie können sich aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen zusammensetzen. Lehrveranstaltungsstunden können auch ganz oder teilweise zu größeren Einheiten (Blockveranstaltungen) zusammengefasst werden, insbesondere wenn dies der Einübung berufspraktischer Qualifikationen dient. Der Arbeitsaufwand für die einzelnen Module („Workload“) setzt sich aus Präsenzzeiten (hieraus errechnen sich die Semesterwochenstunden, SWS), Zeiten des Selbststudiums und der Prüfungsvorbereitung zusammen.
(
4
)
Die Module werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) bewertet; jedem Modul ist eine bestimmte Anzahl von Credit-Points (CP) zugeordnet.
(
5
)
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Module und die zugehörigen Lehrveranstaltungen und die Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus der Übersichtstabelle in Anlage 3.
(
6
)
Die Form, in der Prüfungsleistungen (PL) erbracht werden, ist in § 8 festgelegt.
(
7
)
Lehrveranstaltungsübergreifende Prüfungsleistungen sind mit dem Vermerk LüP gekennzeichnet.
#§ 55
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen
Wahlmöglichkeiten bei Prüfungsleistungen sind in der Anlage zu den §§ 53 Abs. 2 und 54 (Anlage 3) durch einen Schrägstrich gekennzeichnet.
#§ 56
Studienaufbau und Prüfungen
(
1
)
Die für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderlichen Module und Lehrveranstaltungen sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen ergeben sich aus Anlage 3 zu § 54.
(
2
)
Alle studienbegleitenden Modulprüfungen mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Module sind zu benoten und für die Bildung der Gesamtnote relevant.
(
3
)
Bei den studienbegleitenden Modulprüfungen des Moduls
„Fachpraktikum III“
erfolgt keine Benotung, sondern nur das Testat „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“.
#§ 57
Berechnung der Gesamtnote
(
1
)
Die Gesamtnote für den Bachelor-Abschluss setzt sich zusammen:
- aus dem nach dem ECTS-Punkteanteil gewichteten Durchschnitt der Noten aller benoteten studienbegleitenden Modulprüfungen sowie
- der Note für die Bachelorthesis und
- der Note für die mündliche Abschlussprüfung.
(
2
)
An der Gesamtnote nach Absatz 1 hat Absatz 1 Nr. 1 einen Anteil von 80%, Nr. 2 einen Anteil von 15% und Nr. 3 einen Anteil von 5%.
#C. Schlussbestimmungen
#§ 58
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelungen
(
1
)
Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am 30. Januar 2025 in Kraft.
(
2
)
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 im ersten Studiensemester befinden, legen die Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang nach der neuen Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 1) ab.
(
3
)
Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 1) in einem Studiengang nach § 1 in einem höheren als dem ersten Studiensemester befinden, legen die Prüfungsleistungen nach der jeweils bisher geltenden Studien- und Prüfungsordnung (Absatz 2) ab. Einzelne Module, die nach einer Änderung nicht mehr angeboten werden, können durch geeignete Module nach der aktuellen SPO ersetzt werden.
(
4
)
Im Übrigen können Studierende, die ihr Studium nach § 1 unter Geltung einer älteren als der in Absatz 2 genannten Studien- und Prüfungsordnung begonnen, es aber unterbrochen haben, auf Antrag die Prüfungsleistungen nach dieser bisherigen Studien- und Prüfungsordnung ablegen. Der Antrag kann erst nach Beratung der entsprechenden Studierenden durch die zuständige Dekanin bzw. den zuständigen Dekan beim Prüfungsamt (§ 4) gestellt werden.
(
5
)
Diese Satzung wird gemäß § 10 Abs. 2 EH-G nach Genehmigung durch das Kuratorium im Gesetzes- und Verordnungsblatt (GVBl.) der Landeskirche bekannt gemacht.
Freiburg, 30.01.2025
#__________________________________
Freiburg, den 30. Januar 2025
Die Rektorin
Prof.in. Dr.in Renate Kirchhof
Bekanntmachungen
Nr. 48Zusammenschluss von Pfarrgemeinden in Offenburg
(Kirchenbezirk Ortenau)
(Kirchenbezirk Ortenau)
ORK: 13.03.2025
####Mit Wirkung ab 1. Januar 2026 werden die Pfarrgemeinden Auferstehungsgemeinde, Erlösergemeinde, Christusgemeinde, Johannes-Brenz-Gemeinde, Lukasgemeinde Schutterwald, Matthäusgemeinde und Stadtkirchengemeinde in Offenburg zusammengeschlossen. Der Pfarrdienst der Evangelischen Kirchengemeinde verfügt über sieben Pfarrstellen. Pfarrstelle I-V umfasst jeweils ein volles Dienstverhältnis; Pfarrstelle VI und VII ein auf ½ eingeschränktes Dienstverhältnis:
- Pfarrstelle I der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle II der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle III der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle IV der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle V der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle VI der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg,
- Pfarrstelle VII der Evangelischen Kirchengemeinden Offenburg.
Nr. 49Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts
„Evangelischer Kirchenfonds St. Nikolai Altlußheim“
„Evangelischer Kirchenfonds St. Nikolai Altlußheim“
OKR: 12.03.2025
AZ.: 5111-01 Altlußheim
####AZ.: 5111-01 Altlußheim
Der Evangelische Kirchenfonds St. Nikolai Altlußheim wurde durch Beschluss des Kirchengemeinderats vom 13. März 2024 aufgelöst. Sein Vermögen fällt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge an die Evangelische Kirchengemeinde Altlußheim.
Nr. 50Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts
„Evang. Heiligen- und Almosenfonds Eichtersheim
bzw. Evang. Heiligenfonds Eichtersheim
bzw. Evang. Kirchenfonds Eichtersheim“
„Evang. Heiligen- und Almosenfonds Eichtersheim
bzw. Evang. Heiligenfonds Eichtersheim
bzw. Evang. Kirchenfonds Eichtersheim“
OKR: 03.04.2025
AZ.: 5611 Eichtersheim
####AZ.: 5611 Eichtersheim
Der Evang. Heiligen- und Almosenfonds Eichtersheim bzw. Evang. Heiligenfonds Eichtersheim und der Evang. Kirchenfonds Eichtersheim wurden durch Beschluss des Kirchengemeinderats vom 14. November 2024 aufgelöst. Deren Vermögen fällt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge an die Evangelische Kirchengemeinde Angelbachtal.
Nr. 51Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts „ Evang. Kirchenalmosenfonds Eschelbronn bzw. Evang. Kirchenfonds Eschelbronn“
OKR: 03.04.2025
AZ.: 5111-01 Eschelbronn
####AZ.: 5111-01 Eschelbronn
Der Evang. Kirchenalmosenfonds Eschelbronn bzw. Evang. Kirchenfonds Eschelbronn wurde durch Beschluss des Kirchengemeinderats vom 26. September 2024 aufgelöst. Sein Vermögen fällt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge an die Evangelische Kirchengemeinde Eschelbronn.
Nr. 52Kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts „ Evang. Heiligenfonds Reihen bzw. Evang. Kirchenfonds Reihen“
OKR: 03.04.2025
AZ.: 5111-01 Reihen
####AZ.: 5111-01 Reihen
Der Evang. Heiligenfonds Reihen bzw. Evang. Kirchenfonds Reihen wurden durch Beschluss des Kirchengemeinderats vom 09. September 2024 aufgelöst. Dessen Vermögen fällt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge an die Evangelische Kirchengemeinde Reihen.
Stellenausschreibungen
Nr. 53Stellenausschreibungen
####Auf der Website finden Sie eine aktuelle Übersicht zu freien Pfarrstellen, freien Stellen für Diakon*innen und freien Stellen im Religionsunterricht
#I. Freie Stellen für Pfarrer*innen (w/m/d) (Bewerbungsschluss: 10.06.2025) (Link)
Pfarrstellen mit gemeindlichem Auftrag
- Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald: Neustadt (Kooperationsraum: Dreisamtal-Hochschwarzwald)
Pfarrstellen mit allgemeinem kirchlichem Auftrag
- EOK, Referat 2 -Personalreferat: Leitung Personaleinsatz
- Theologische und geistliche Leitung des Bildungs- und Tagungszentrums der Evangelischen Kirche in Pforzheim HOHENWART FORUM
#II. Freie Stellen für Diakon*innen (w/m/d) (Bewerbungsschluss: 10.06.2025) (Link)
Stellen mit gemeindlichem Auftrag
- Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald: Ihringen und Bötzingen (Kooperationsraum Kaiserstuhl)
- Kirchenbezirk Markgräflerland: Oberes Kandertal (Kooperationsraum Rebland-Kandertal)
| Herausgeber: Ev. Oberkirchenrat, Blumenstraße 1–7, 76133 Karlsruhe Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, Telefon 0721 9175 0 Erscheint (i. d. R.) einmal im Monat. Satz & Druck: Mediengestaltung und Hausdruckerei d. Ev. Oberkirchenrats in Karlsruhe. |